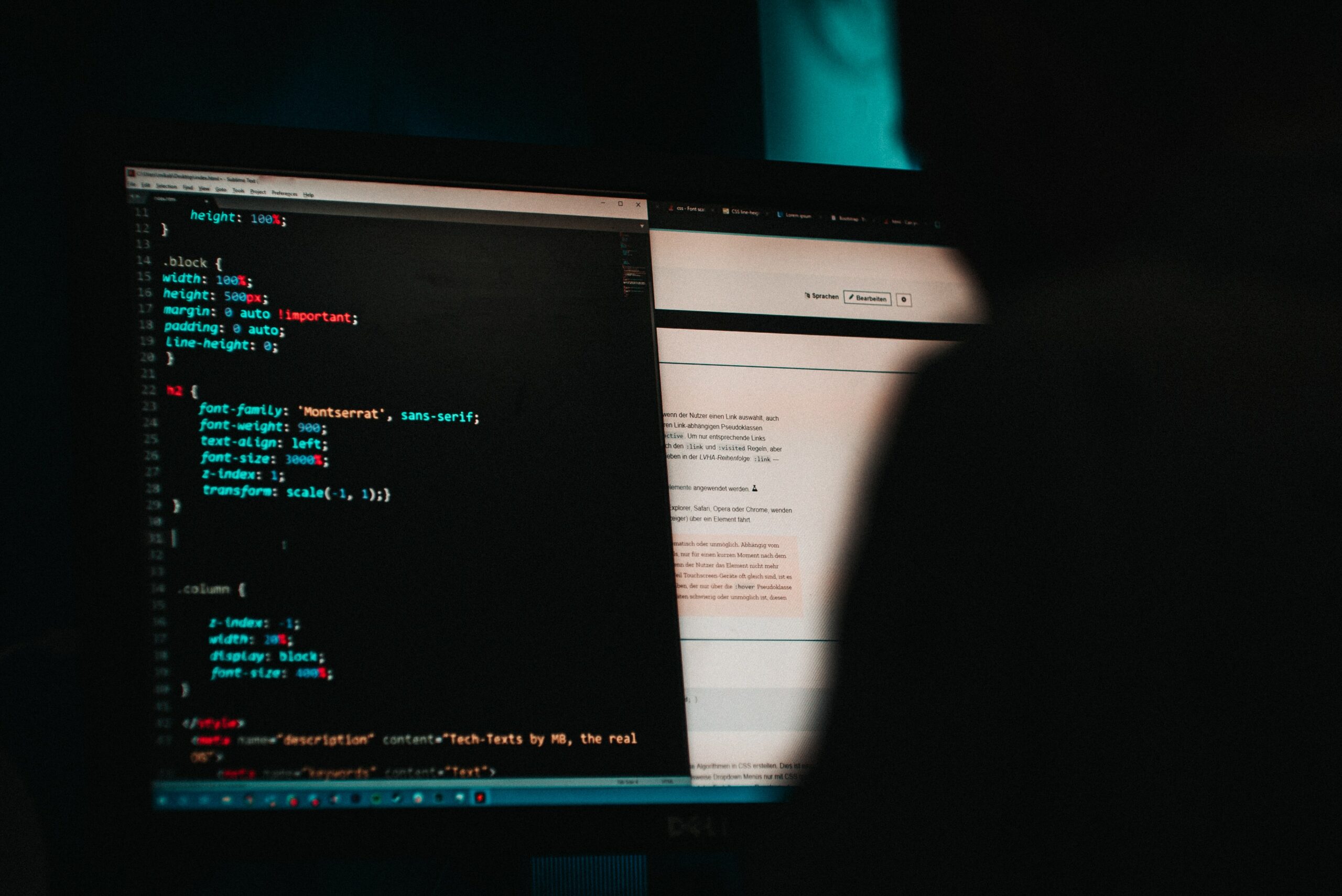Einleitung
Die EU will sog. Gatekeeper-Unternehmen wie Google, Amazon oder Apple künftig in ihrer Marktmacht regulieren zugunsten fairer Wettbewerbsbedingungen für digitale Unternehmen. Dafür werden derzeit zwei Gesetzespakete entwickelt, der »Digital Services Act« und der »Digital Markets Act«. Noch sind sich EU-Parlament und der Ministerrat nicht einig, aber es gibt Fortschritte.
Das Gesetzesvorhaben für den Digital Markets Act wurde bereits im Dezember 2020 initiiert. Am 24. März 2022 gab es dann endlich eine erste Einigung.
Diese Einigung muss noch von den EU-Abgeordneten und Mitgliedstaaten offiziell angenommen werden, was vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Ein Parallelvorhaben ist der Digital Services Act (DSA), der bereits im Januar 2022 im EU-Parlament beschlossen wurde.
Beide Gesetzesentwürfe sollen nach Abschluss aller Verhandlungen in Form einer Verordnung umgesetzt werden, die dann für sämtliche Mitgliedstaaten gelten wird.
Ein Inkrafttreten beider Gesetzesvorhaben wird allerdings nicht vor 2023 erwartet.
Was regelt der Digital Markets Act?
Der Digital Markets Act will verhindern, dass Unternehmen überhaupt erst zu Gatekeeper-Unternehmen heranwachsen können, bevor sie (kartell-)rechtlich verfolgt werden. Die Regulierungen zielen auf rechtzeitige und angemessene Maßnahmen ab, die es Einzelunternehmen erschweren, ihre Marktmacht auszubauen und die Entwicklung der Konkurrenz zu verhindern.
Als Gatekeeper werden solche Unternehmen bezeichnet,
- die mindestens 6,5 Mrd. EURO Jahresumsatz im europäischen Wirtschaftsraum erzielen,
- sowie über 45 Mio. Endnutzer pro Monat haben und
- über 10 Tsd. gewerbliche Nutzer nachweisen.
Außerdem müssen sie einen signifikanten Einfluss im Binnenmarkt ausüben, d.h. in mehreren Mitgliedstaaten unternehmerisch aktiv sein. Dafür ist es nicht erforderlich, dass das Unternehmen seinen Sitz in der EU hat. Zurzeit erfüllen ungefähr 10 bis 15 Unternehmen diese Kriterien, wie beispielsweise Google, Amazon, facebook, Apple & Co.
Die Feststellung, ob man als Gatekeeper-Unternehmen gilt, müssen die Unternehmen zunächst selbst vornehmen. Gemäß des DMA trifft die Unternehmen diesbezüglich eine Anzeigepflicht gegenüber der EU-Kommission.
Wie werden Gatekeeper künftig reguliert?
- Gatekeeper dürfen keine unfairen Bedingungen für andere Unternehmen, Geschäftskunden und Verbraucher schaffen. Hier orientiert sich der Regelgeber an bereits laufenden oder abgeschlossenen Untersuchungsverfahren wegen Missbrauchs der Marktmacht.
- Bei Firmenübernahmen soll mehr Kontrolle ausgeübt werden können, damit kleinere Unternehmen nicht einfach vom Markt weggekauft werden.
- Gewerbliche Nutzer sollen auf Kunden- und Transaktionsdaten zuzugreifen können, jedoch nur auf solche, welche sie selbst auf den Gatekeeper-Plattformen generieren. Derartiges ist für Händler von Verkaufsplattformen zurzeit nicht möglich.
- Eine der Kernforderungen ist die Interoperabilität von Messenger-Diensten. Es sollen künftig Nachrichten zwischen verschiedenen Anbietern verschickt werden können.
- In Sachen personalisierte Werbung gibt es zwar kein absolutes Verbot, dennoch sollen Minderjährige stärker geschützt werden. Die Datenzusammenführung ohne vorherige ausdrückliche Einwilligung wird verboten.
- Auch dürfen Gatekeeper nicht mehr auf die Suchergebnisanzeige einwirken, um ihre eigenen Dienste und Produkte höher zu setzen, sog. self-preferencing.
- Sie dürfen Kunden nicht mehr daran hindern, sich an Unternehmen außerhalb ihrer Plattform zu wenden.
In strengen Ausnahmesituationen soll es sogar erlaubt sein, Gatekeeper-Konzerne zu zerschlagen, wenn diese wiederholt und systematisch gegen die Auflagen verstoßen.
Ansonsten arbeitet der DMA mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 10 % des Jahresumsatzes. Das EU-Parlament forderte sogar eine Bußgeldhöhe von bis zu 20 % des Jahresumsatzes. Diese Forderung fand jedoch keine Zustimmung.
Was regelt der Digital Services Act?
Der Digitale Services Act beschränkt sich im Gegensatz zum DMA nicht nur auf Gatekeeper-Unternehmen, sondern richtet sich an alle digitalen Dienste. Daher werden auch Internetprovider, Vergleichs- oder Buchungsportale, App-Stores oder Cloud-Services eingeschlossen. Der DSA möchte eine sichere und vertrauenswürdige Online-Umgebung für alle schaffen.
Um Benachteiligungen zu vermeiden, werden die Unterschiede der verschiedenen Dienste im Rahmen eines abgestuften Regelungssystems innerhalb des DSA berücksichtigt. Auch die E-Commerce-Richtlinie (2000/31/EC) wird teilweise abgelöst. Es hat sich gezeigt, dass die Mitgliedstaaten jeweils ihre eigenen nationalen Regelungen eingeführt haben, was zu einem unübersichtlichen Flickenteppich an Vorschriften geführt hat. Das möchte der DSA korrigieren.
Der bisherige Gesetzesentwurf ist umfangreicher als der Gesetzesentwurf zum DMA. Er zielt auf den Schutz der Nutzer ab.
Nachfolgend geben wir Ihnen einen groben Überblick über die Themen, die im DSA künftig geregelt werden:
- Online-Marktplätze sollen die Identität ihrer Händler verstärkt prüfen, um Produktsicherheit zu gewährleisten. Damit entstehen unter anderem neue “due-diligence-Pflichten“ für Online-Marktplätze. Durch die Identitätsprüfung ist es Markeninhabern auch möglich, besser gegen Produktfälschungen vorzugehen. Zusätzlich sollen sog. Trusted Flagger zum Einsatz kommen, damit man zuverlässige Händler besser erkennen kann.
- Große Plattformbetreiber, sog. VLOPs (Very Large Online Platforms), sollen jährlich mindestens eine eigene Risikobewertung vornehmen, um zu überprüfen, wie sich die Verbreitung illegaler oder falscher Inhalte auswirkt. Sie sollen illegale oder falsche Inhalte löschen oder gezielt moderieren können. Empfehlungssysteme sorgen dabei für zuverlässigere Informationsquellen. Insbesondere illegale Inhalte sollen durch Host-Provider schneller entfernt werden dürfen (Notice-and-Action-System). Dem Nutzer wird vor der Löschung jedoch eine Widerspruchsmöglichkeit eingeräumt.
- Die Funktionsweise von Algorithmen soll transparenter werden, damit Nutzer ein besseres Verständnis für die technischen und analytischen Abläufe bekommen. Dies soll ihnen helfen, Suchmaschinen und ihre Ergebnisse zu verstehen.
- An Minderjährige gerichtete personalisierte Werbung soll gänzlich verboten sein. Volljährige Nutzer dagegen können selbst entscheiden, ob ihnen personalisierte Werbung angezeigt wird oder nicht. Ganz wichtig: Den Nutzern sollen die Abläufe im Hintergrund transparent gemacht werden, damit sie verstehen können, wie es überhaupt dazu kommt, dass ihnen ganz bestimmte Werbung angezeigt wird.
- Einfach zugängliche Meldesysteme soll es Nutzern und Betroffenen künftig leichter machen, sich zu beschweren.
Hinsichtlich der VLOPs behält sich die Kommission eigene Untersuchungs- und Eingriffsbefugnisse vor. Die Durchsetzung des DSA hingegen ist Sache der einzelnen Mitgliedstaaten.
Bei Verstößen wird ein Bußgeld in Höhe von 6 % des weltweiten jährlichen Konzernumsatzes fällig.
Kritik
Es klingt erst einmal gut, dass Großplattformbetreiber und Gatekeeper an die Leine genommen werden sollen, um Platz für fairen Wettbewerb zu lassen.
Dennoch sind die avisierten Regelungen auch kritisch zu betrachten.
Es ist gewagt, ein völlig neues Regulierungsmodell zu schaffen, ohne dieses mit den bereits vorhandenen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften zu verknüpfen.
Es besteht die Gefahr einer doppelten Verfolgung, einmal im Rahmen der Verordnung und andererseits nach europäischen wettbewerbsrechtlichen Regelungen. In diesem Zusammenhang ist auch noch nicht geklärt, in welchem Verhältnis das nationale Kartellrecht, allen voran § 19a GWB, angewendet werden soll.
Hinsichtlich des Verbots von personalisierter Werbung bei Minderjährigen wird es wohl kaum eine Umsetzung in der Praxis geben, weil letzten Endes keine Überprüfung stattfindet, wer tatsächlich den PC nutzt.
Dies gilt auch im Hinblick auf die Interoperabilität zwischen den Diensten, die technisch zwar möglicherweise umsetzbar ist, jedoch erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken bzgl. der unkontrollierten Datenweitergabe aufwirft.
Da der DSA die Verwendung von Upload-Filtern anerkennt, könnte eine erneute urheberrechtliche Diskussion über die Verwendung dieser Filter entfacht werden.
Der DSA gewährt erhebliche Eingriffsmöglichkeiten bei falschen und illegalen Inhalten. Doch ist es noch nicht abschließend geklärt, welche Inhalte überhaupt darunterfallen und wer eine entsprechende Bewertung vornimmt. Dadurch könnte es zu einer Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit kommen.
Fazit
Die Hoffnungen der EU sind groß, dass DMA und DSA einen größtmöglichen Nutzen für die Regulierung der digitalen Marktwirtschaft bringen. Einige Regelungen werden sicherlich dazu beitragen. Doch bleibt die Umsetzung abzuwarten. Da die Verhandlungen noch nicht endgültig abgeschlossen sind, sind Änderungen nach wie vor möglich.
Dennoch lässt sich bereits jetzt festhalten, dass der Umfang der zu beachtenden Regeln stark an die Größe eines Unternehmens gekoppelt sein wird.
Und natürlich wird es für große Unternehmen teuer und aufwändig, die neuen gesetzlichen Vorgaben umzusetzen.
Ein Inkrafttreten ist nicht vor 2023 geplant. Mit der geplanten Übergangsfrist von 6-12 Monaten dürfte es also erst 2024 zu einer faktischen Umsetzung kommen.
Über die weiteren Entwicklungen werden wir Sie hier gerne informieren.