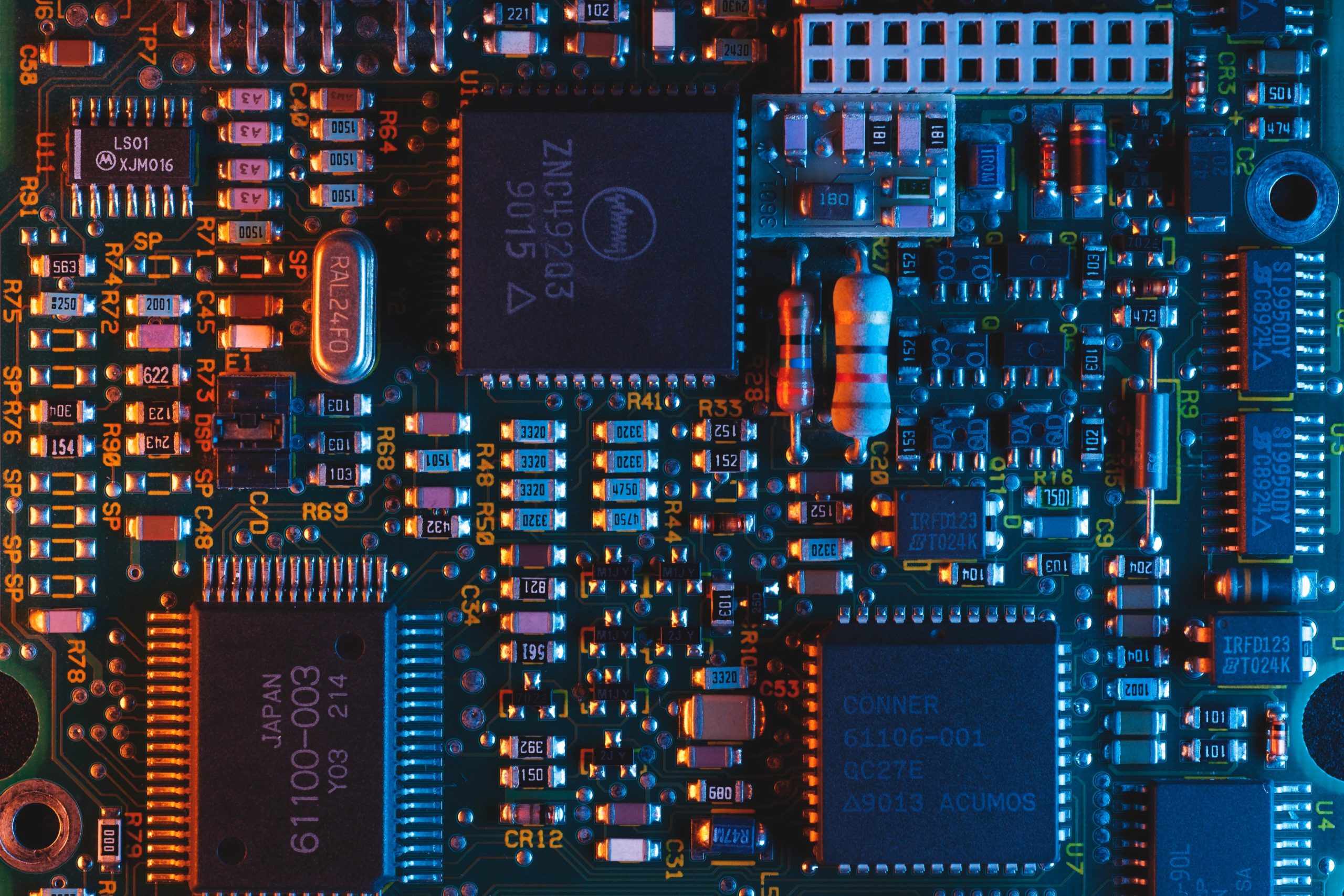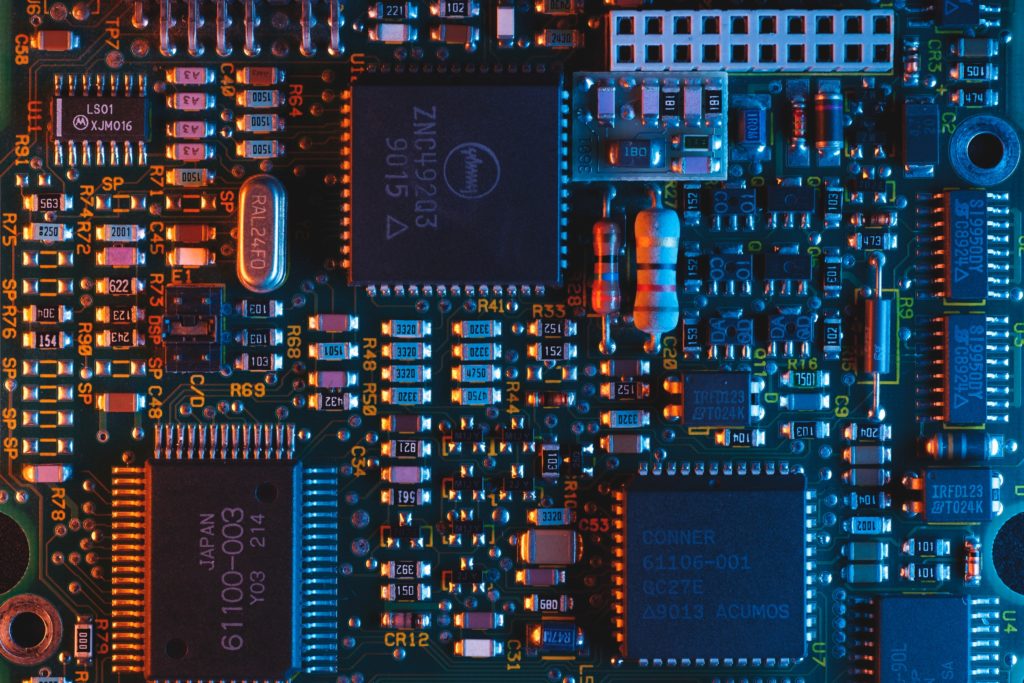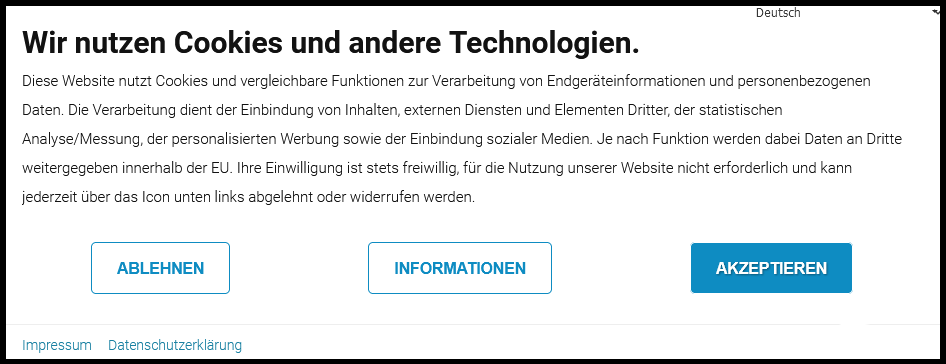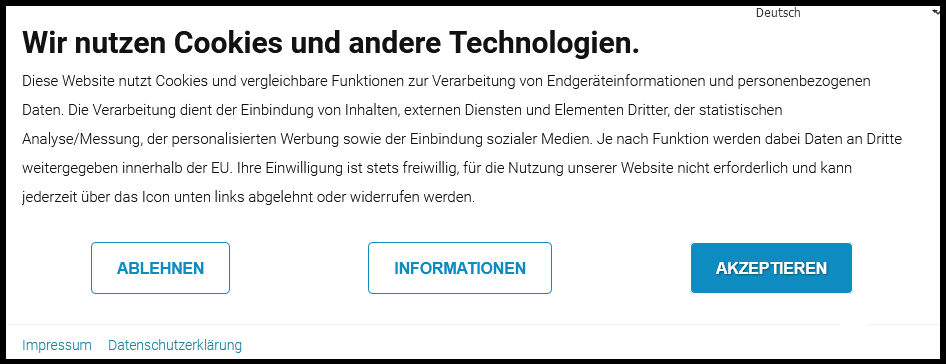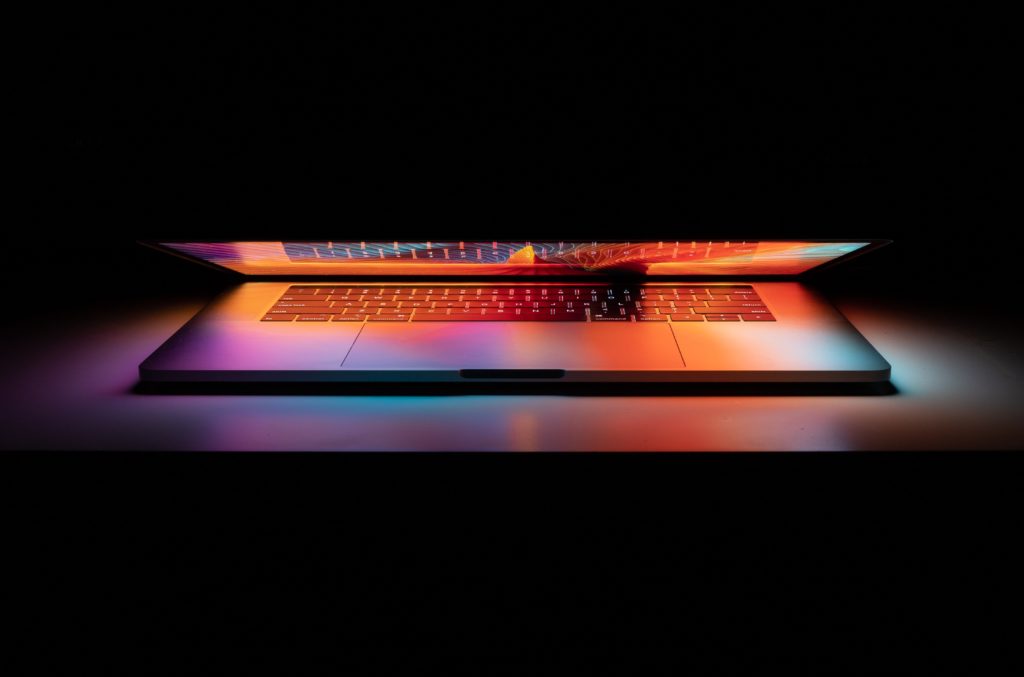Die Politikerin Renate Künast kann einen Etappensieg feiern: die Beschlüsse des Landgerichts und Kammergerichts Berlin, welche die Hetzkommentare größtenteils als hinnehmbar einstuften, wurden vom BVerfG jetzt aufgehoben.

Stand März 2022
BVerfG: Hetzkommentare in Sozialen Netzwerken sind nicht anstandslos hinzunehmen
Einführung
Gerade im Zeitalter der sozialen Medien stellt sich häufig die Frage, wie weit die Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Grundgesetz (GG) geht und was sich Empfänger von Hetzkommentaren alles gefallen lassen müssen. Nun hat das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) sich erneut mit dieser Frage beschäftigt. Dem einschlägigen Beschluss (BVerfG, Beschl. v. 19.12.2021, Az.: 1 BvR 1073/20) liegen zahlreiche beleidigende Kommentare auf Facebook zugrunde, die Anfang 2019 gegen die Grünen-Politikerin Renate Künast gerichtet waren. Es fielen hierbei u.a. Ausdrücke wie “Pädophilen-Trulla”, “Gehirn Amputiert” und “Stück Scheiße”. Hiergegen wendete sich Frau Künast und verlangte von der Betreiberin der Social Media Plattform Facebook, dass diese die personenbezogenen Daten der Verfasserinnen und Verfasser der jeweiligen Kommentare gem. § 14 Abs. 3 Telemediengesetz in der alten (damals geltenden) Fassung (TMG a.F.; heute: § 21 Abs. 2, 3 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG)) an sie herauszugeben, damit sie gegen sie rechtlich weiter vorgehen könnte. In erster und zweiter Instanz verweigerten jedoch sowohl das Landgericht (LG) als auch das Kammergericht (KG) Berlin die Auskunftsansprüche größtenteils, da sie in der Mehrheit der Kommentare keine Beleidigungen sahen. Grund dafür war zum Teil, dass die Äußerungen genügend Sachbezug zur erneut aufgekommenen „Pädophilie-Debatte“ aus dem Jahr 2015 hätten, in der es vorwiegend um die Haltung der „Grünen“ zur Pädophilie in den 1980er Jahren ging, so die Berliner Gerichte.
Gegen die Berliner Beschlüsse legte Frau Künast Verfassungsbeschwerde beim BVerfG ein. Im Folgenden wird der Beschluss des BVerfG erläutert und zudem darauf eingegangen, anhand welcher Kriterien eine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit auf der einen Seite und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Sicht des BVerfG auf der anderen Seite stattzufinden hat.
Entscheidung des BVerfG
Nach Auffassung des Karlsruher Gerichts haben die vorinstanzlichen Gerichte das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Politikerin gem. Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG nicht ausreichend berücksichtigt. Bei Hetzkommentaren, insbesondere wenn es um deren Zulässigkeit geht, sei immer zwischen Schmähkritik und anderen verletzenden Aussagen mit Sachbezug zu differenzieren. Schmähkritik bezeichnet dabei Äußerungen, bei denen die betroffenen Personen lediglich herabgewürdigt und diffamiert werden sollen, ohne dass die Aussage einen Sachbezug aufweist. Diese Aussagen sind nach ständiger Rechtsprechung stets als Beleidigungen i.S.d. § 185 Strafgesetzbuch (StGB) anzusehen und unterfallen daher nicht (mehr) der allgemeinen Meinungsfreiheit nach Art. 5 Abs.1 GG.
Nach Ansicht des BVerfG seien die Berliner Richterinnen und Richter jedoch vorschnell und unzutreffend davon ausgegangen, dass einige Kommentare keine Beleidigungen i.S.d. § 185 StGB darstellen würden, nur weil sie keine Schmähkritik seien. Sofern die jeweiligen Aussagen keine Schmähkritik darstellen würden, sondern außerdem einen Sachbezug hätten oder zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen würden, müsse von den Gerichten in einem weiteren Schritt zwischen der Meinungsfreiheit der Verfasserin oder des Verfassers und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Opfers abgewogen werden. Es gebe jedoch keine Vermutung eines generellen Vorrangs der Meinungsfreiheit, auch nicht bei Personen, die in der Öffentlichkeit stehen.
Das LG und das KG hätten diese Abwägung aber gerade nicht vorgenommen, sondern mit der Begründung, dass bei den Kommentaren ein Sachbezug zur Pädophilie-Debatte aus 2015 vorläge, eine Schmähkritik und damit auch eine Beleidigung schließlich abgelehnt. Letzteres dürfe so aber per se nicht geschehen. Aufgrund dieses Abwägungsausfalls der Vorinstanzen hat das BVerfG mithin einen Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG festgestellt und deshalb die Beschlüsse der Berliner Gerichte (LG, Beschl. v. 07.09.2019, 21.01.2020, Az.: 27 AR 19/19; KG, Beschl. v. 11.03.2020, 06.04.2020, Az.: 10 W 13/20) aufgehoben. Das BVerfG hat in seiner Entscheidung hierbei den Sachverhalt nicht in Gänze, sondern lediglich auf Grundrechtsverletzungen überprüft. Deshalb hat das BVerfG den Fall auch zur erneuten Prüfung des Auskunftsanspruchs gem. § 14 Abs. 3 TMG a.F. an das KG Berlin zurückverwiesen, sodass dieses sich nochmals mit den Hetzkommentaren im Einzelnen auseinandersetzen muss.
Kriterien für die Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht
Das Karlsruher Gericht betonte in seinem Beschluss erneut (vgl. BVerfG, Beschl. v. 19.05.2020, Az.: 1 BvR 2397/19), auf welche Kriterien bei der Abwägung zwischen Art. 5 Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG abzustellen sei. Die hierbei nun mehr aufgestellten Punkte seien aber keinesfalls zwingend bei jeder Abwägung heranzuziehen, sondern sollen lediglich einen Leitfaden bilden.
- Zunächst sei zu beachten, dass die Meinungsfreiheit umso stärker ins Gewicht falle, je mehr ein Beitrag oder eine Aussage darauf ziele, der öffentlichen Meinungsbildung zu dienen bzw. umso geringer, je mehr es davon unabhängig lediglich um die persönliche Meinung gegenüber einer anderen Person ginge.
- Zudem sei es bedeutend, ob es sich bei der getroffenen Aussage um Machtkritik handele – denn diese sei besonders schutzwürdig. Politikerinnen und Politiker müssten für deren Art und Weise der Machtausübung auch angegriffen werden können. Jedoch folge daraus nicht, dass Amtsträgerinnen und Amtsträger vom Schutz vor Beleidigungen und Verächtlichmachungen ausgenommen seien. Deren Persönlichkeitsrechte seien ebenso hinreichend zu wahren wie die von jeder anderen Person auch.
- Relevant sei des Weiteren, ob die Aussagen spontan gefallen seien oder ob sie mit Vorbedacht getätigt wurden. Äußerungen in sozialen Netzwerken seien nach Ansicht des BVerfG keine Spontanäußerungen, sondern solche mit Vorbedacht, für die ein strengerer Maßstab gelte.
- In die Abwägung könne außerdem miteinfließen, wie viele Personen die Äußerungen zur Kenntnis genommen hätten und ob sie schriftlich fixiert und damit jederzeit abrufbar seien.
Fazit
Das KG Berlin muss sich im Ergebnis nochmals mit den Hetzkommentaren gegen Frau Künast auseinandersetzen und dabei nach Auffassung des BVerfG vermutlich zu einem anderen Ergebnis kommen. Es ist also festzuhalten, dass bisher noch nicht abschließend geklärt ist, ob die Aussagen strafbar sind und ob Frau Künast einen Anspruch auf Herausgabe der Nutzerdaten hat. Das Karlsruher Gericht hat lediglich festgestellt, dass die vorherigen Beschlüsse Frau Künast in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzen, weil keine ausreichende Abwägung mit der Meinungsfreiheit stattgefunden hat. Dennoch stellte das BVerfG auch klar, dass Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich nicht wie bisher häufig angenommen, alles bzw. mehr hetzerische Kritik gefallen lassen müssen, sondern gegen Beleidigungen ebenfalls geschützt sind.
Mit seinem Beschluss stärkt das BVerfG mithin die Persönlichkeitsrechte von Opfern von Hasskommentaren. Gerichte sind nun dazu verpflichtet, in solchen Fällen eine ausführliche Abwägung zwischen den widerstreitenden Interessen vorzunehmen.
Bisher scheiterten zivilrechtliche Ansprüche meist daran, dass die Verfasserinnen und Verfasser von Hetzkommentaren sich im Internet hinter pseudonymisierten Usernamen versteckten und deshalb nicht identifizierbar waren. Durch den Beschluss könnte sich dies nun ändern, da nach der eingehenden Abwägung, jetzt häufiger Beleidigungen angenommen werden könnten, sodass auch häufiger Auskunftsansprüche nach § 21 Abs. 2, 3 TTDSG durchgesetzt werden könnten.