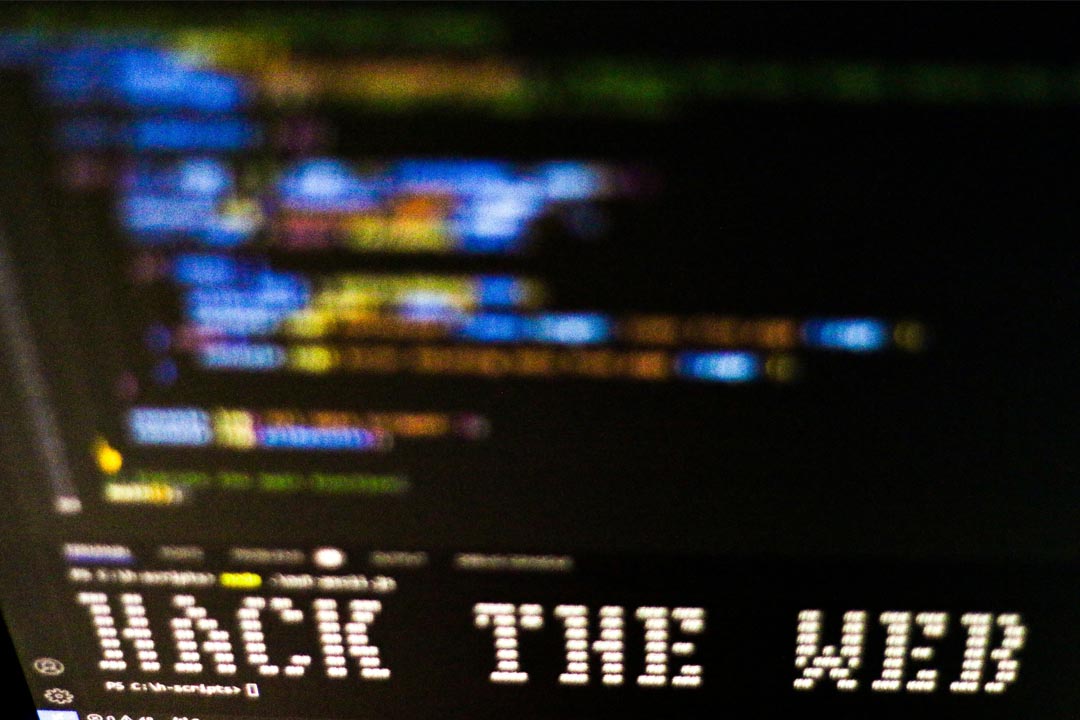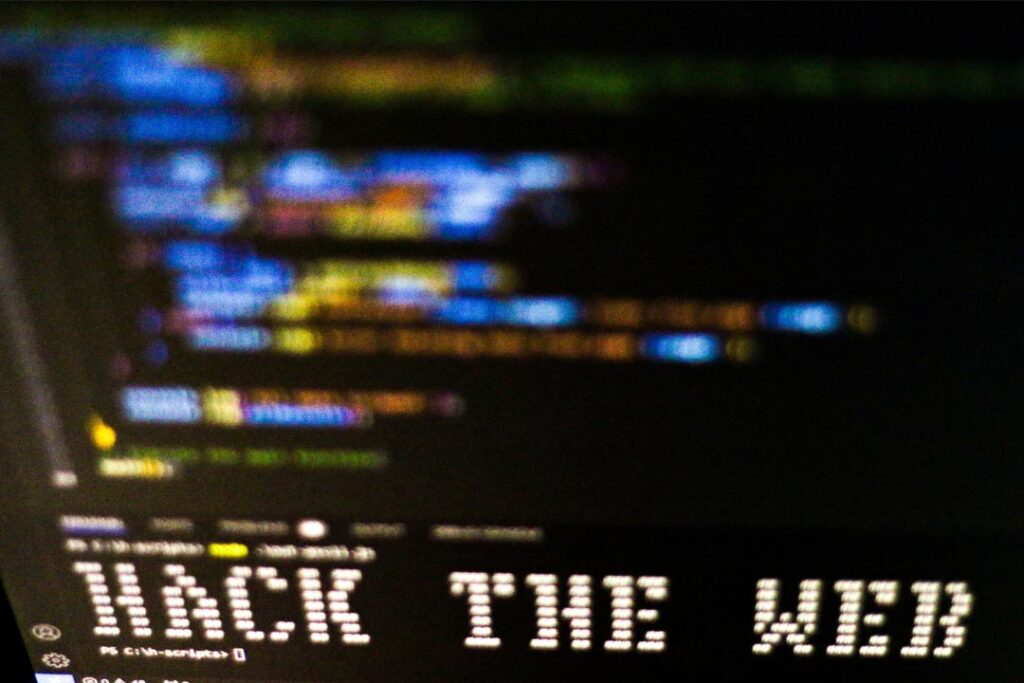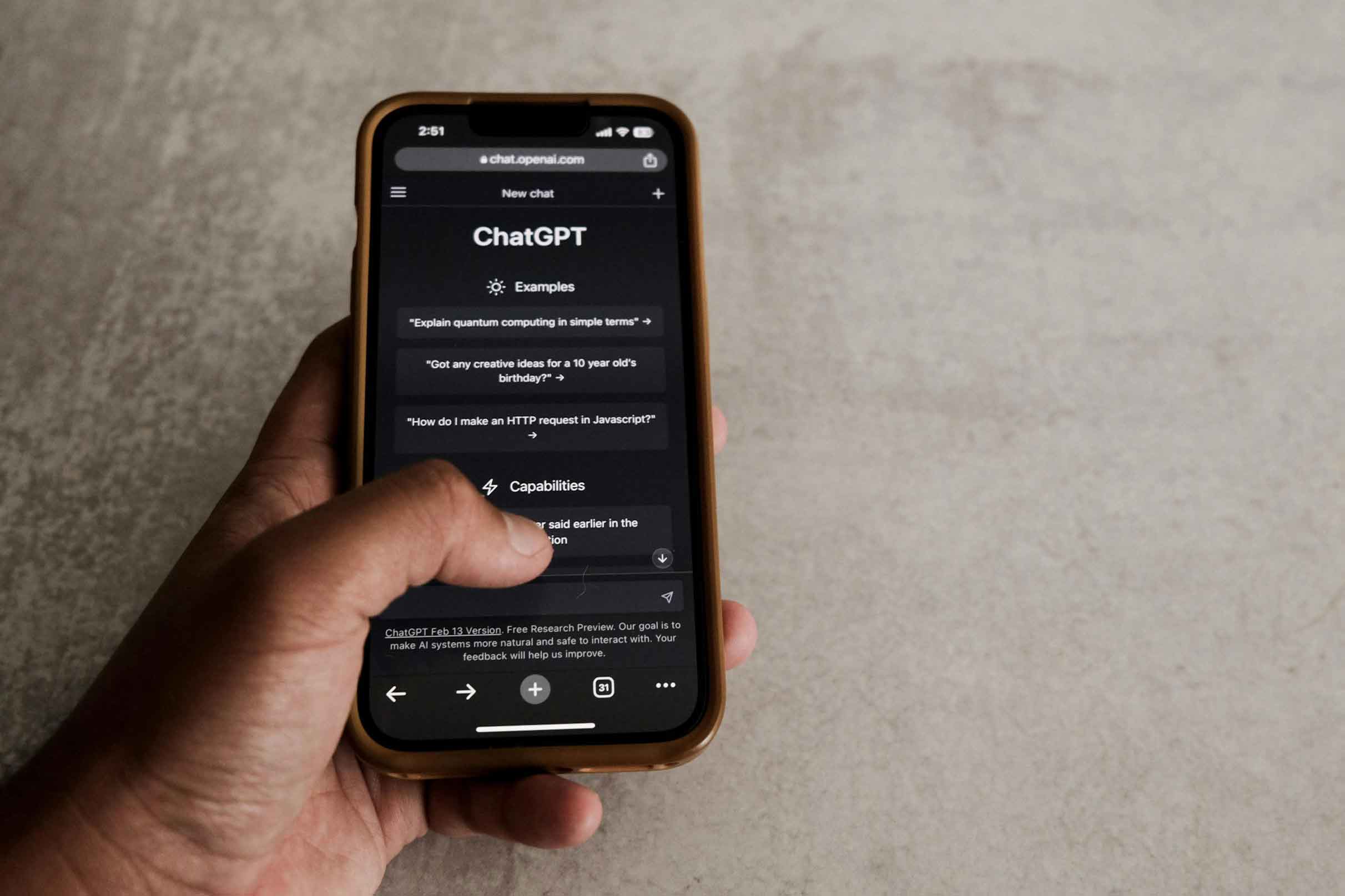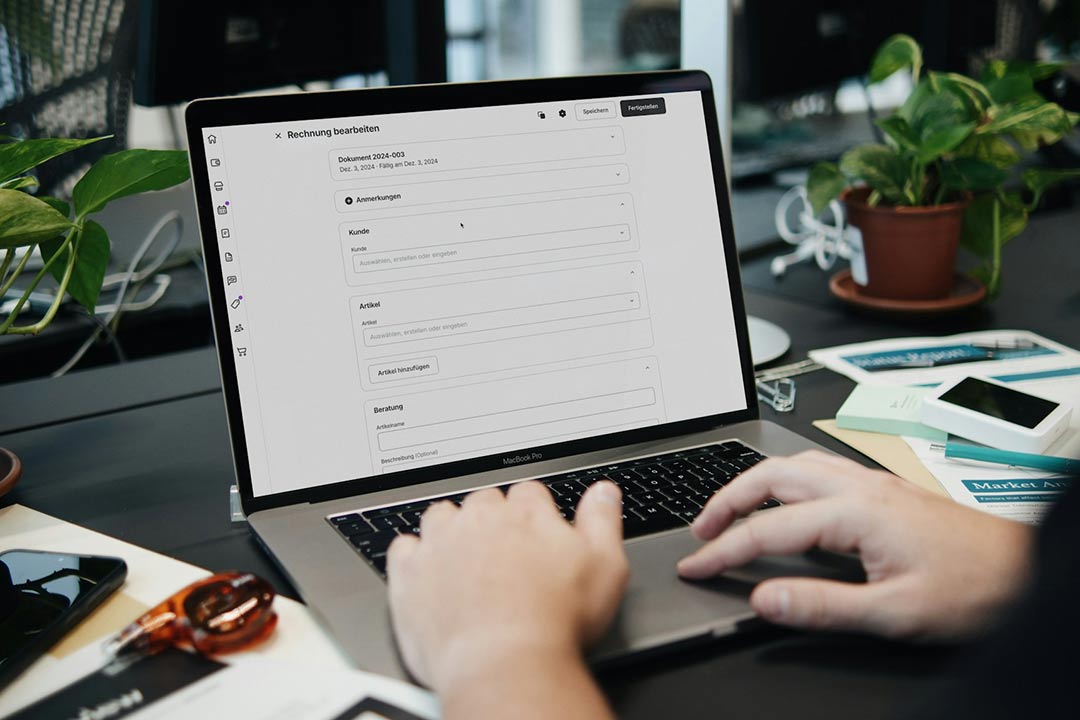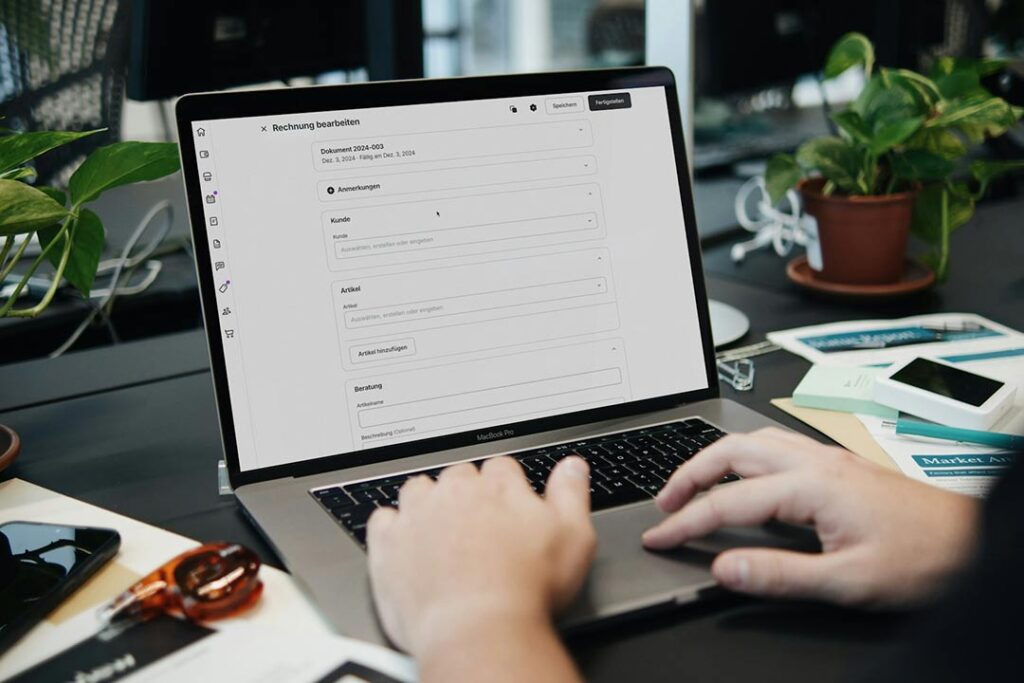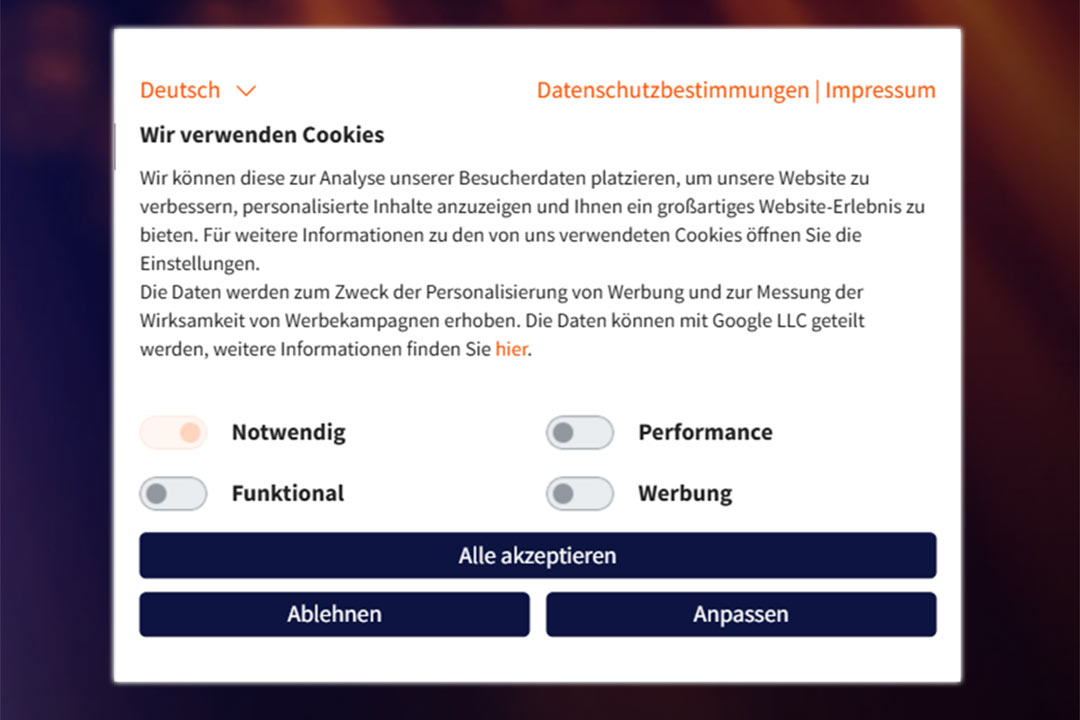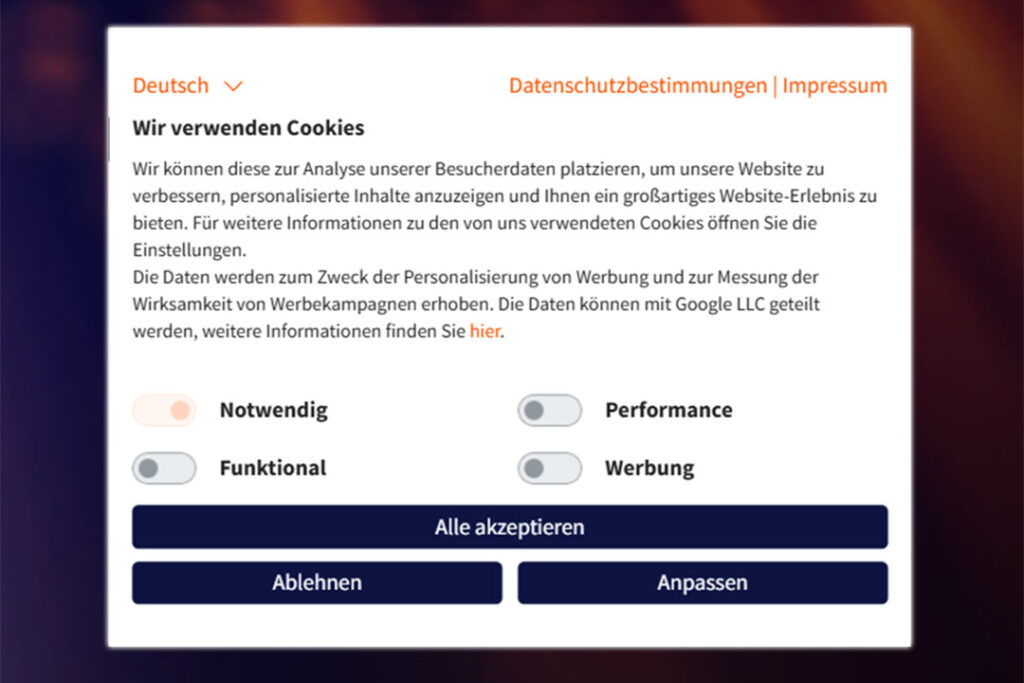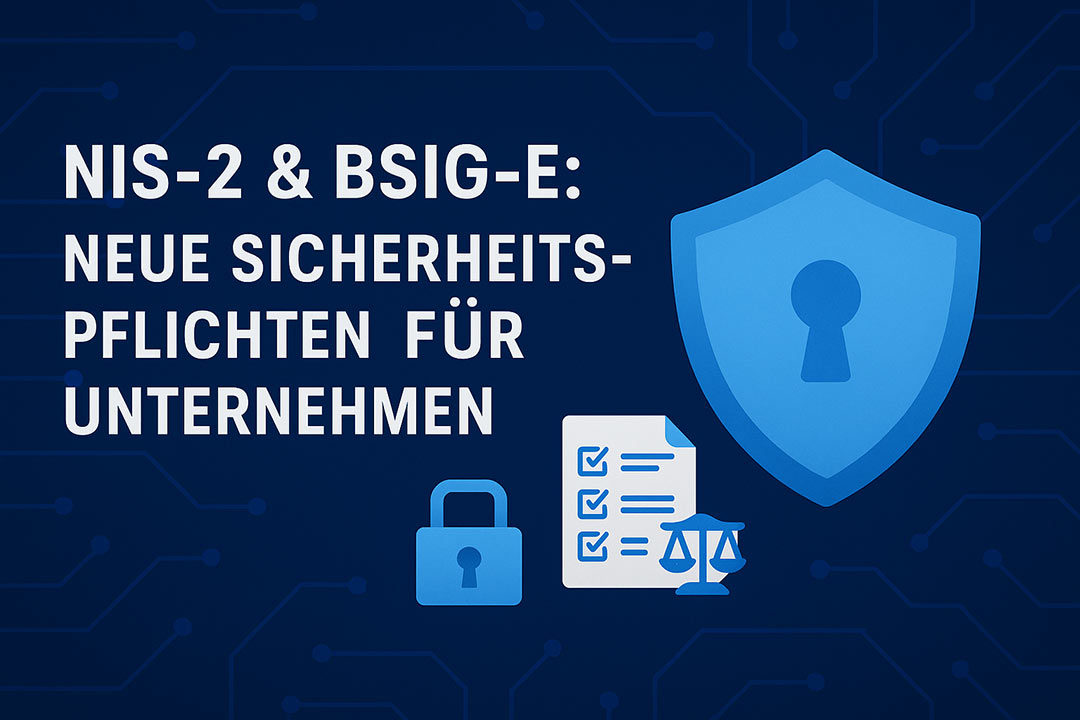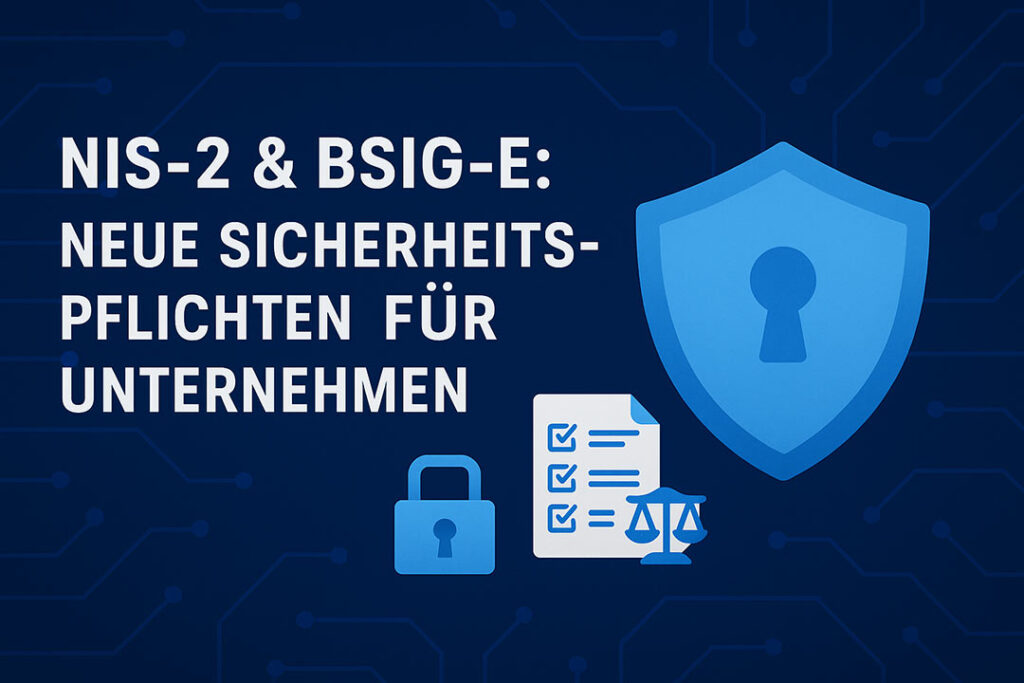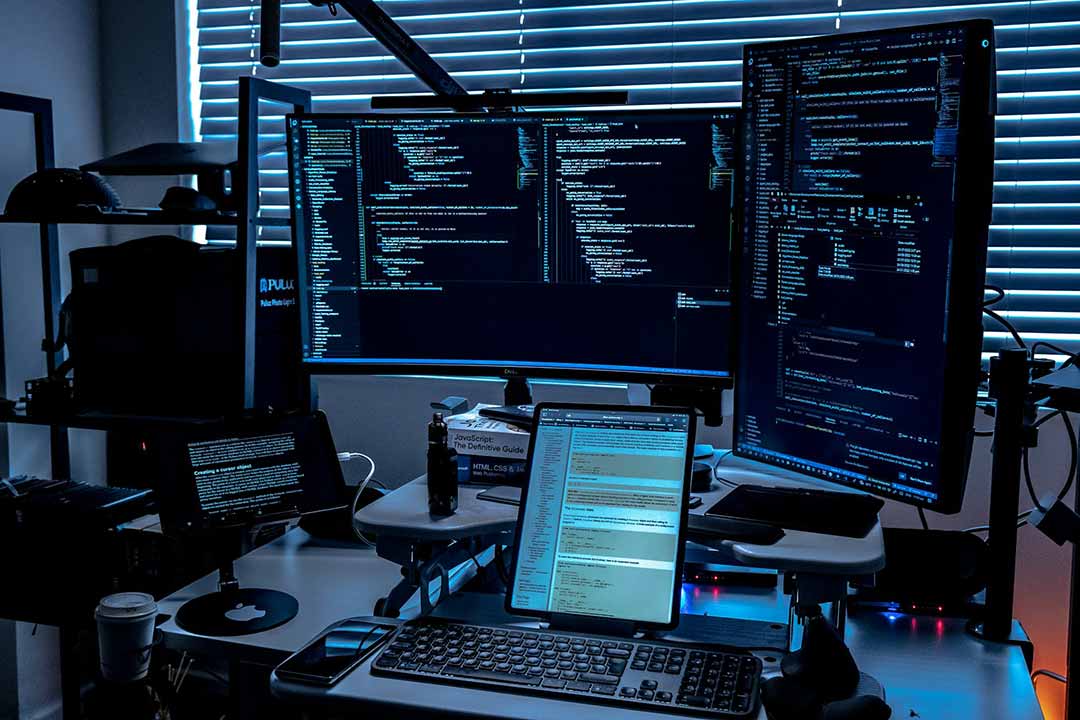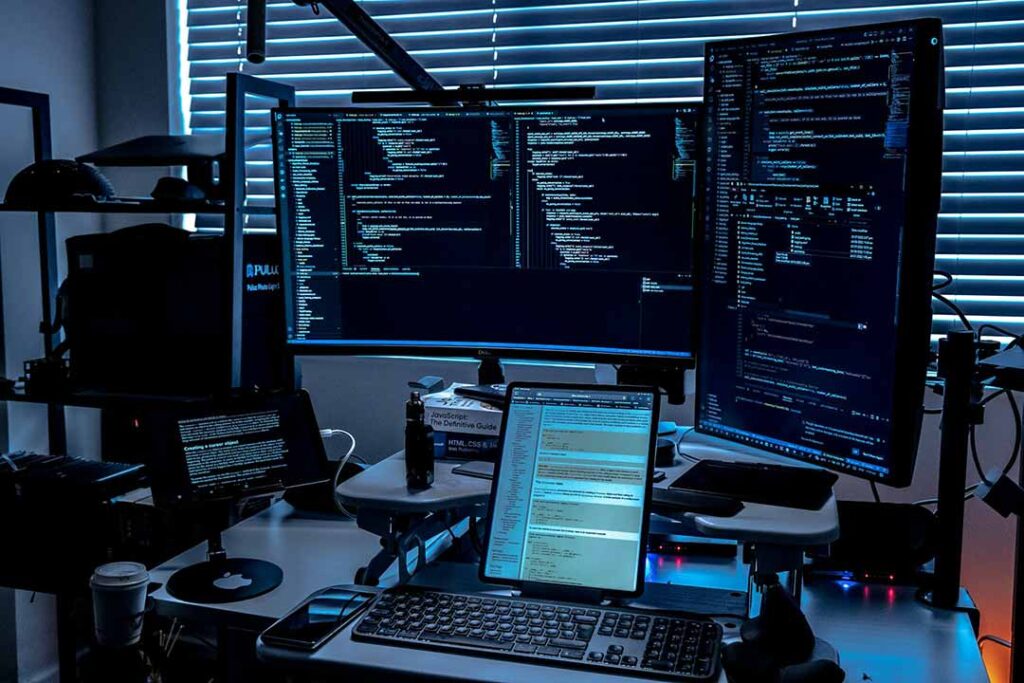Microsoft Teams erfasst Büro-Anwesenheit: Datenschutz- und Arbeitsrechtsfragen im Fokus
Ab Dezember führt Microsoft Teams eine neue Funktion ein: Die Software kann künftig automatisch erkennen, ob sich Mitarbeitende im Büro aufhalten. Grundlage dafür ist die Verbindung mit dem Unternehmens-WLAN. Sobald diese besteht, wird der Standort als aktueller Arbeitsort angezeigt.
Die Idee dahinter: hybride Arbeitsmodelle sollen einfacher koordiniert werden. Doch die Neuerung stößt nicht überall auf Zustimmung. Datenschutzrechtliche und arbeitsrechtliche Fragen stehen im Raum. Kritiker warnen, dass durch die Funktion ein Überwachungsgefühl entstehen könnte. Die Möglichkeit, Anwesenheit automatisch zu erfassen, könnte außerdem den Druck erhöhen, ins Büro zurückzukehren, obwohl Arbeit im Homeoffice keineswegs mit geringerer Produktivität gleichzusetzen ist.
Datenschutz, Einwilligung und Persönlichkeitsrechte
Die kontinuierliche Standortbestimmung greift in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die informationelle Selbstbestimmung ein. Entscheidend wird daher sein, ob Mitarbeitende freiwillig in die Nutzung einwilligen können. Hier bestehen Zweifel, da die Angst vor möglichen Nachteilen bei einer Verweigerung mitschwingen könnte.
Die Anwesenheitserfassung wird jedoch nicht automatisch aktiviert, sondern muss freigeschaltet werden. Vor der Einführung empfiehlt es sich, die rechtlichen Rahmenbedingungen sorgfältig zu prüfen.
Planen Sie, diese Funktion in Ihrem Unternehmen einzusetzen? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Gerne unterstützen wir Sie dabei, die notwendigen Schritte für eine sichere und rechtskonforme Anwendung vorzubereiten.