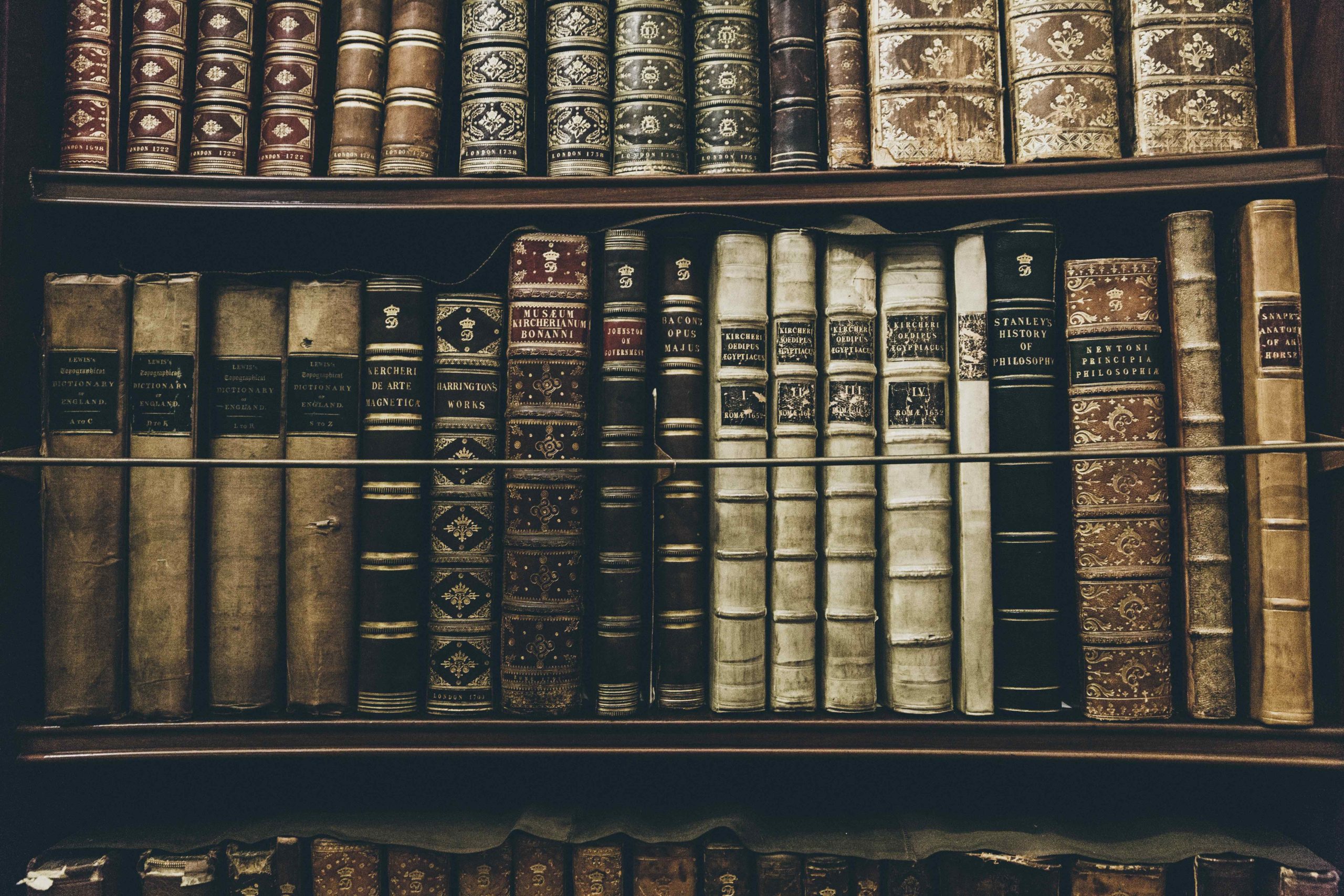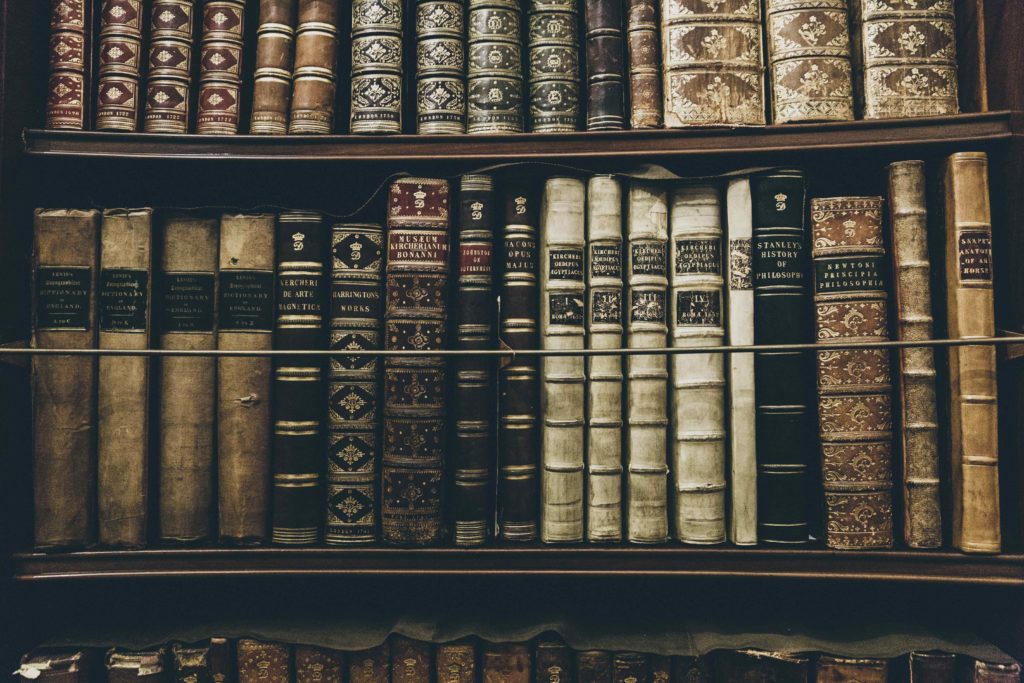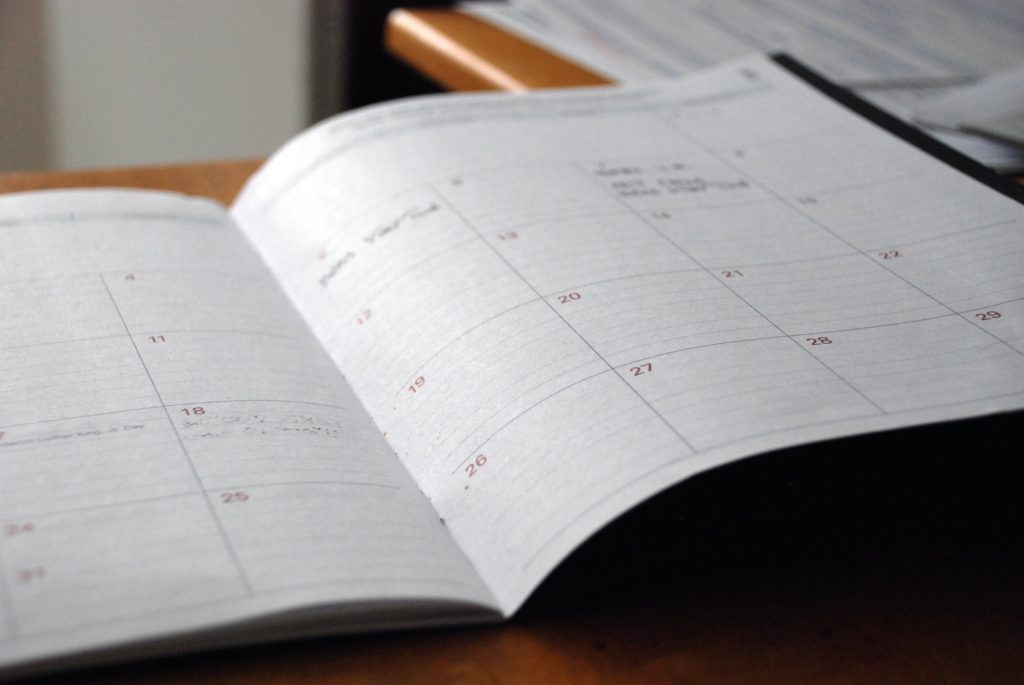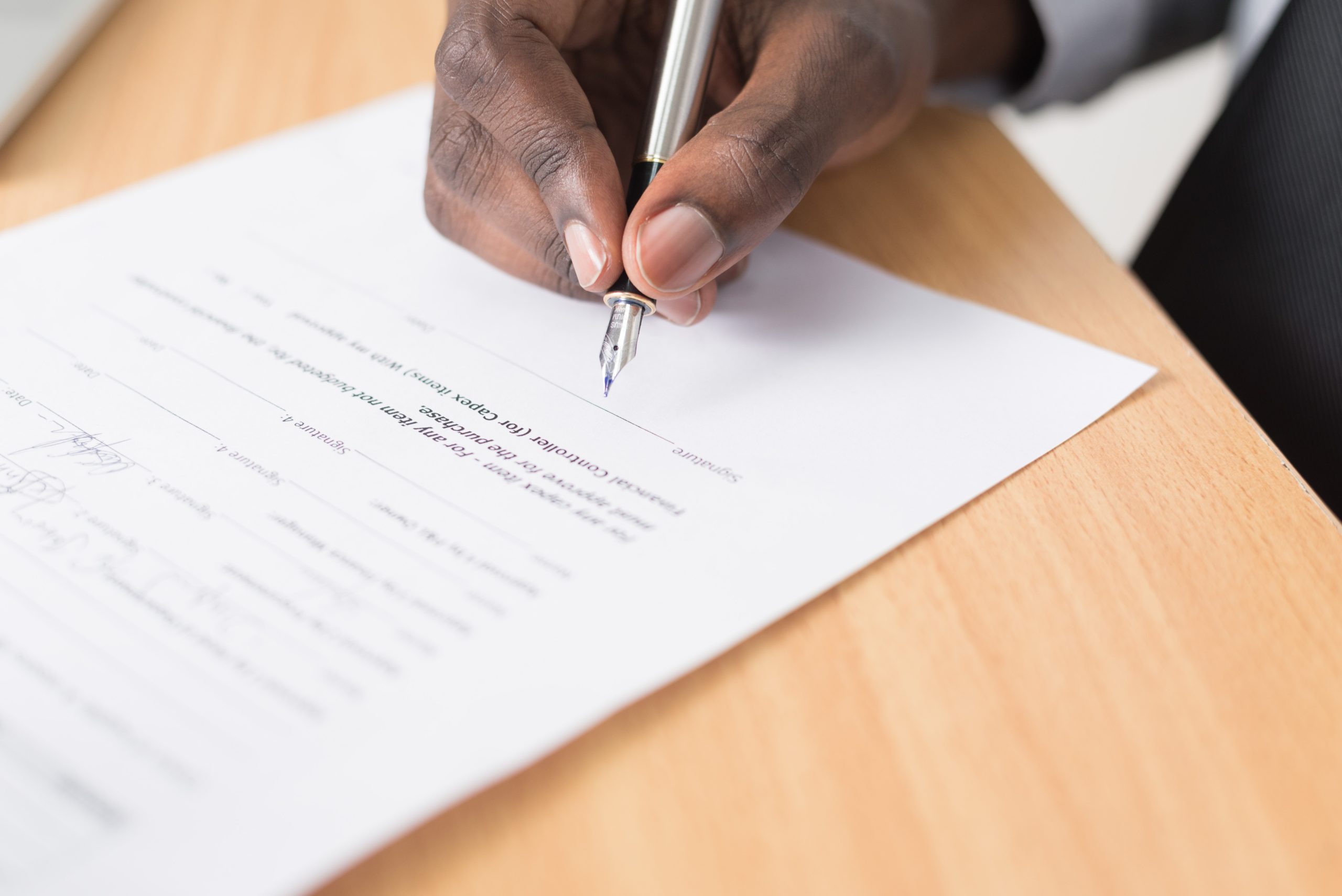Im Folgenden gehen wir näher auf die vertraglichen Beziehungen beim Kauf von Apps ein.

Rechtliche Betrachtung von App-Käufen
Einführung
Ein Klick und vielleicht noch ein kurzes, unbedachtes Tippen auf den Akzeptieren-Button und schon ist die App runtergeladen. Dabei passiert aus rechtlicher Betrachtungsweise in diesem kurzen Vorgang eine Menge zwischen dem Anbieter, dem Store-Betreiber und dem Anwender, was rechtlich nicht immer eindeutig eingeordnet werden kann. Kaufe ich mit dem Herunterladen die App und erhalte ich nur Nutzungsrechte daran? Wer ist eigentlich mein Vertragspartner, der Anbieter oder der Betreiber? Und welche Willenserklärung mit welchem genauen Inhalt wird wann von wem abgegeben?
Vertragsbeziehungen der Beteiligten
Sowohl Google als auch Apple unterscheiden zwischen zwei Kategorien von App-Produkten: Zum einen die Apps, die von Google oder Apple selbst entwickelt wurden und zum anderen sog. Dritt-Apps, die von einem Drittanbieter entwickelt werden, aber über den Store von Google oder Apple vertrieben werden.
Die Vertragsverhältnisse in der ersten Konstellation sind eindeutig: Geht es um den Download einer eigens entwickelten App, so wird der Store Betreiber unzweifelhaft Vertragspartner. So sehen es auch die Nutzungsbedingungen der Storebetreiber selbst vor.
Anders verhält es sich, wenn über den Store Dritt-Apps von anderen Anbietern heruntergeladen werden. Ein Blick in die Nutzungsbedingungen von Apple verrät:
„Indem Apple den App Store zur Verfügung stellt, handelt Apple als Vertreter für App-Provider [Anbieter / Entwickler] und ist keine Partei des Kaufvertrages oder der Benutzervereinbarung zwischen Ihnen und dem App-Provider.“
Auch Google formuliert eine ähnliche Klausel. Es soll also aus Sicht der Store Betreiber direkt ein Vertrag zwischen dem Anwender und dem Anbieter, also dem Entwickler der App zu Stande kommen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht: Für den Nutzer ergibt sich ein völlig anderes Bild. Beim Download einer App nimmt der Nutzer ausschließlich den Store Betreiber als Vertragspartner wahr, der ihm direkt gegenübersteht. Daher wird teilweise in der juristischen Literatur angenommen, dass eine bloße Erwähnung eines Anbieters bzw. Entwicklers nicht ausreiche, anzunehmen, dass dieser tatsächlich auch Vertragspartner werde. Denn dies entspreche nicht der Wahrnehmung des Endkunden.
Eine andere Ansicht betont, dass der Nutzer den Store eher als Marktplatz betrachte, ähnlich wie die Angebote bei Ebay oder Amazon und der Store Betreiber als technischer Dienstleister hinter dem App-Entwickler zurücktrete. Aus Nutzerperspektive würde also ein Vertrag mit dem Anbieter der App geschlossen. Gleichzeitig sei die Nutzerperspektive jedoch falsch und der Blick auf das Verhältnis zwischen Store Betreiber und Anbieter zu lenken. Denn aus den Verträgen zwischen App-Store und Anbieter ergäbe sich, dass kein direkter Vertrag zwischen Nutzer und Anbieter gewollt sei.
Aus Sicht anderer Stimmen in der juristischen Literatur, die die herrschende Meinung darstellen, wiederum, soll maßgeblich auf den objektiven Empfängerhorizont abgestellt und die Auslegung der Willenserklärungen nach allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen vorgenommen werden, sodass es von der konkreten Gestaltung des Vertriebs abhänge, wer Vertragspartner werde. Doch auch nach dieser Betrachtungsweise sind unterschiedliche rechtliche Konstruktionen denkbar:
Kommissionsgeschäft
Aus dem Developer Program License Agreement (iDPLA) und auch der Formulierung, der Store Betreiber wolle nur als Vertreter auftreten, geht hervor, dass ein Kommissionsgeschäft gem. § 383 HGB beabsichtigt sein könnte. Dabei würde der Store Betreiber im eigenen Namen auf fremde Rechnung handeln, also auf Rechnung der Entwickler. Der Annahme eines Kommissionsgeschäfts steht jedoch entgegen, dass der Kommissionär dann auch selbst Vertragspartner werden würde. In den Nutzerbedingungen wird jedoch eindeutig jeder direkte Vertragsschluss zwischen dem Store und dem Nutzer ausgeschlossen, so zumindest bei Apple, sodass die eigenen vertraglichen Ausarbeitungen bereits widersprüchlich wären und ein Kommissionsgeschäft hier nicht sachgemäß erscheint.
Mittelbare Stellvertretung
Lässt man das Innenverhältnis zwischen Store Betreiber und Anbieter zunächst außer Betracht und stellt auf den objektiven Erklärungswert des Vertreterhandelns ab, käme auch eine Stellvertretung nach §§ 164 ff. BGB in Betracht. Nach dem Offenkundigkeitsprinzip muss der Vertreter erkennbar im Namen des Vertretenen auftreten, es muss also deutlich werden, dass der Vertretene und nicht der Vertreter Vertragspartner werden soll. Fraglich ist hier dann also, ob das Verhalten des App-Store und die Erwähnung in den AGB den Anforderungen des Offenkundigkeitsprinzips genügen. Aus dem Sinn und Zweck des Offenkundigkeitsprinzips und auch der Wertung des § 164 Abs. 2 BGB ergibt sich, dass aus dem Handeln des Vertreters und nicht aus dessen Willen hervor gehen muss, wer Vertragspartner werden soll. Aus objektiver Betrachtungsweise und vor dem objektiven Empfängerhorizont erscheint aber der App-Store als Vertragspartner. Auch die fehlende Anbieterkennzeichnung nach § 5 Abs. 1 TMG und die Informationen nach § 312d BGB für den Entwickler sprechen dagegen, ihn als Vertragspartner zu werten.
Aktueller Stand bei Google und Apple
Nach den vorgenannten Erwägungen kommt es also maßgeblich darauf an, wie der App-Store auftritt und inwiefern der Anbieter für den Nutzer als tatsächlicher Vertragspartner erkennbar ist. Bei Google haben sich die Nutzungsbedingungen in den letzten Jahren weitgehend konkretisiert und der Vertragspartner festgelegt, sodass bei Dritt-Apps immer der Anbieter Vertragspartner wird. Apple dagegen schließt in seinen Nutzungsbedingungen noch immer aus, bei dem Verkauf einer Dritt-App Vertragspartner zu werden, obwohl das äußere Erscheinungsbild eher dahin zu deuten ist, dass Apple die wesentliche Kontrolle über alle Inhalte, Werbung und technische Inhalte innehat, sodass mehr dafür spricht den AppStore als Vertragspartner einzustufen.
Fazit
Entscheidendes Merkmal bei der Beurteilung, zwischen welchen Parteien der Vertragsschluss stattfindet, ist ob der Anbieter ausdrücklich in den App-Stores benannt ist und er für den Nutzer als solcher erkennbar ist, oder ob er hinter den Betreiber zurücktritt. Diese Einschätzung kann jedoch durch Umgestaltung des Stores oder expliziterer Formulierungen in den Nutzungsbedingungen schnell Änderung erfahren, sodass dieses Problem immer aktueller Beurteilung bedarf.
Willenserklärungen der Beteiligten
Bei dem automatischen Vorgang des App-Erwerbs durch wenige Klicks stellt sich bereits die Frage, welcher der Beteiligten wann eine Willenserklärung mit welchem Inhalt abgibt. Konkret: Worin ist das Angebot zu sehen und wer erklärt wann die Annahme?
Wie auch im normalen Geschäftsverkehr stellt das Anbieten eines Produkts noch keine Willenserklärung dar, sondern bloß eine invitatio ad offerendum. Also eine Einladung ein Angebot abzugeben. So wird im Online-Handel beispielsweise nicht schon der Vertrag mit Bestellung geschlossen, sondern erst durch eine Bestätigungsmail des Shop-Betreibers oder Zusendung der Ware. Anders zu beurteilen sind dagegen vollautomatische Systeme: Hier geht man davon aus, dass der Vertrag automatisch abgewickelt werden soll, ohne dass noch eine Annahme erfolgt. Dabei besteht dann ein genereller Geschäftswille und der Produktanbieter erklärt ein „Angebot an jedermann“. Bei dem Kauf von Apps im Onlinestore könnte man zunächst davon ausgehen, dass beim Vertrieb von virtuellen Gütern, bei denen auch kein Bedürfnis besteht den Warenbestand zu überprüfen oder ein Angebot abzulehnen, falls das Produkt nicht mehr vorrätig ist, der komplette Kaufprozess automatisiert ablaufen soll, sodass in dem Bereitstellen im App-Store ein „Angebot an jedermann“ gesehen werden könnte.
Die Nutzungsbedingungen von Google Play dagegen, sagen etwas anderes: „Ihr Vertrag über den Erwerb und die Nutzung von Inhalten gilt als abgeschlossen, sobald Sie von Google eine E-Mail-Bestätigung für den Kauf erhalten.“ Die Klausel klingt zunächst danach, dass die Bestätigungs-E-Mail das Angebot darstellen soll. Näher betrachtet könnte sie jedoch auch unwirksam sein, da bei dem Nutzer durch die tatsächliche Gestaltung des Vertragsschlusses ein anderer Eindruck erweckt würde und es sich somit um eine überraschende Klausel nach § 305c Abs. 1 BGB handeln könnte. Darüber hinaus kann es zu Konstellationen kommen, in denen die Bestätigungs-E-Mail noch nicht erhalten wurde, aber die App bereits installiert wird, was laut Nutzungsbedingungen von Google die Vertragserfüllung darstellt. Dies kann von Google bereits nicht gewollt sein. Vieles spricht also dafür ein „Angebot an jedermann“ anzunehmen, denn der Vertragsschluss liegt voll und ganz in den Händen des Nutzers und damit läge ein Angebot bereits in dem Bereitstellen der App im App-Store.