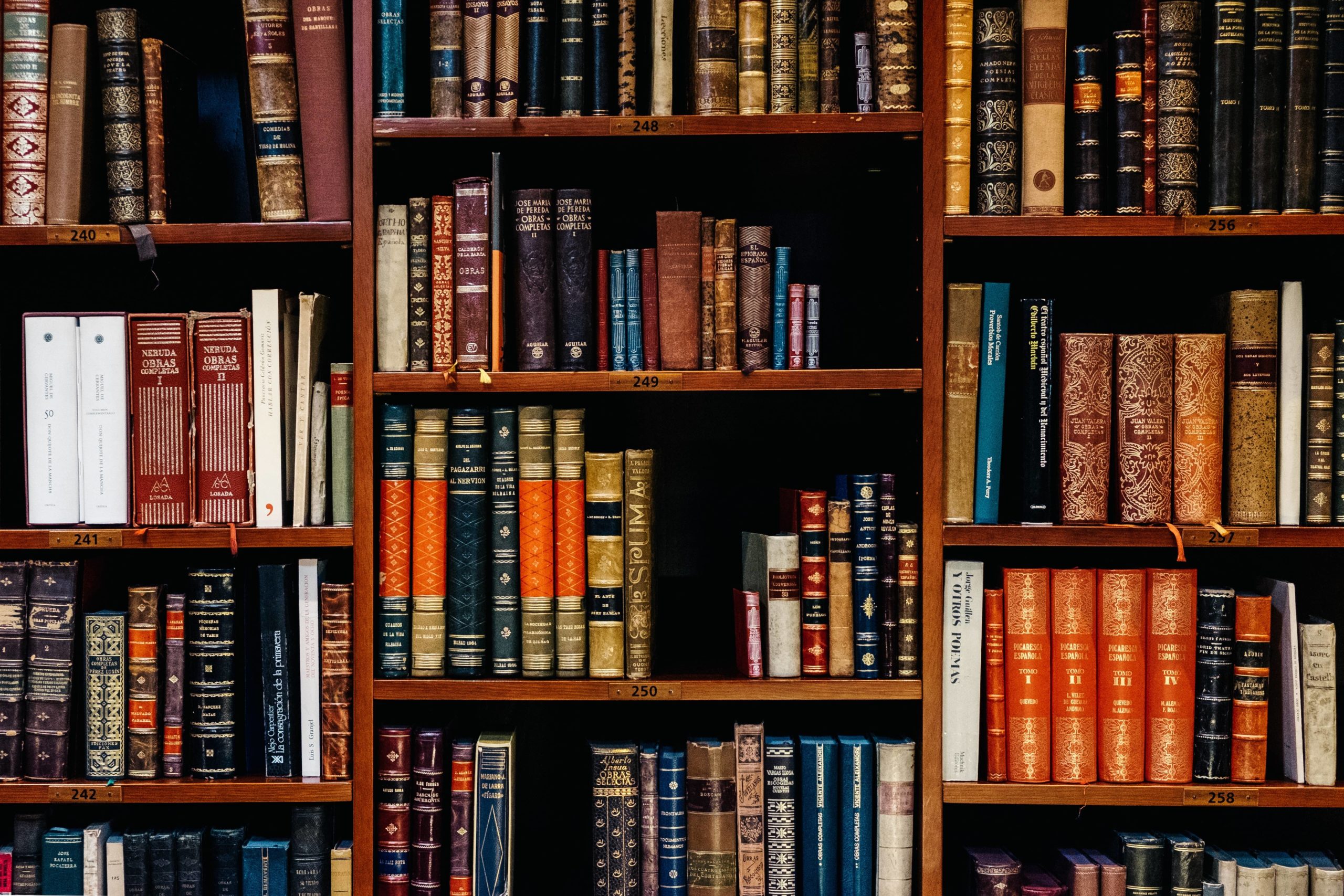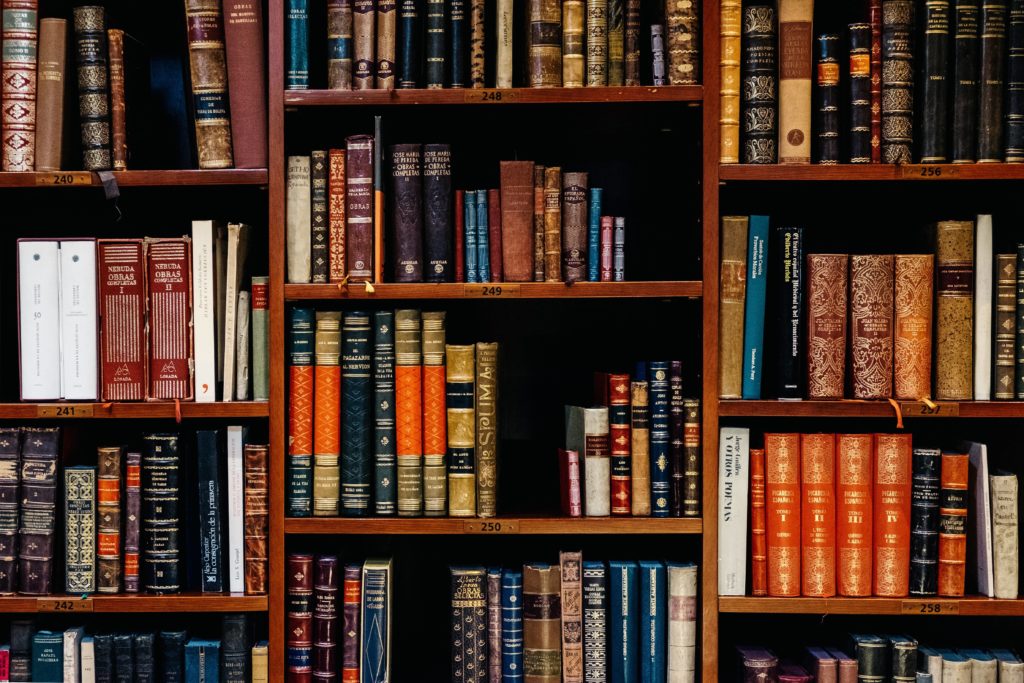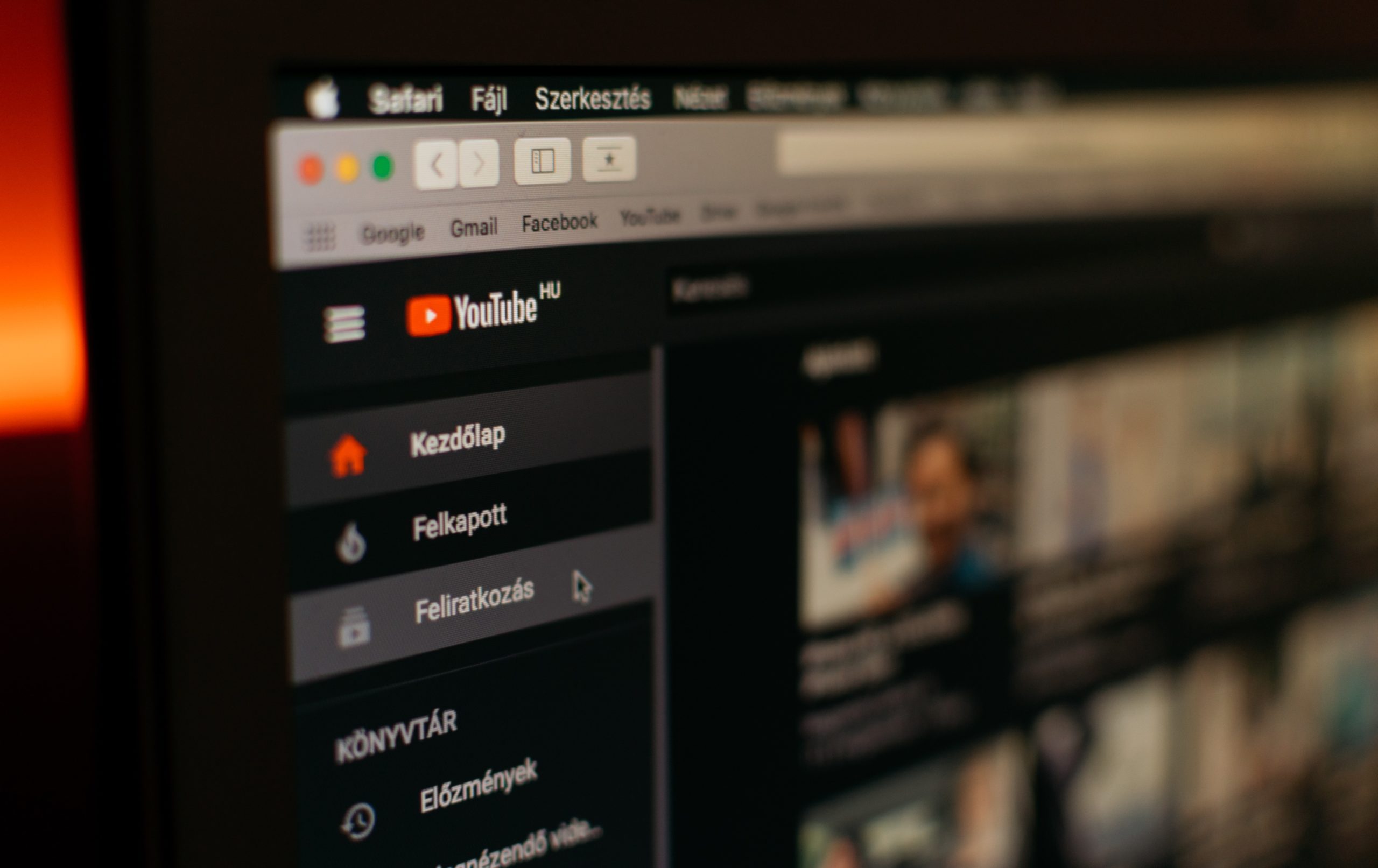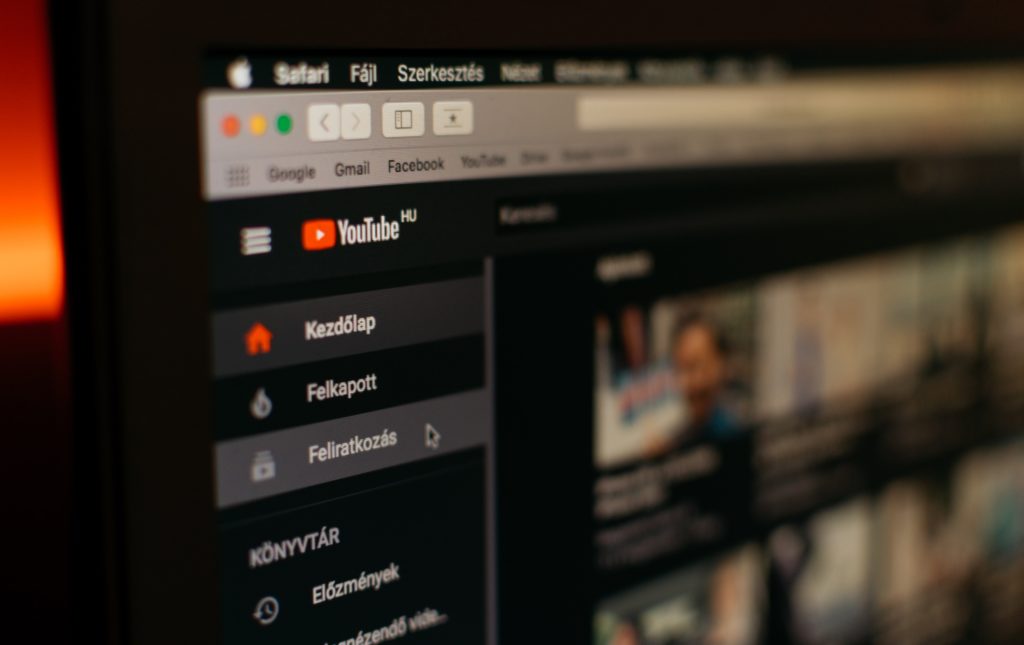Einführung
Haftet YouTube für Urheberrechtsverletzungen seiner Nutzer? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesgerichtshof (BGH) derzeit (Az. I ZR 140/15) und legte in diesem Rahmen am 13.09.2018 einige Frage in Bezug auf die Haftung von YouTube für Urheberrechtsverletzungen durch seine Nutzer dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vor. Die Fragen umfassen die Auslegung der Richtlinie 2001/29/EG (InfoSoc-RL) zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, der Richtlinie 2000/31/EG (ECRL) über den elektronischen Geschäftsverkehr und der Richtlinie 2004/48/EG (Enforcement-RL) zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums.
Der Hintergrund
Die urheberrechtliche Einordnung von Internetplattformen in Bezug auf die Haftung des Plattformanbieters ist durchaus nicht unkompliziert. Verschärft wird das dadurch, dass die europäischen Richtlinien den Mitgliedstaaten zwar einen Regelungsspielraum in Bezug auf die Haftung gewähren, dennoch aber durch die Rechtsprechung des EuGH einige Wertungen hinsichtlich des Haftungssystems des Host-Providers hervortreten und sich somit eine Art europäischen Haftungssystem entwickelt.
Der Schöpfer eines Werkes wird nach § 7 Urhebergesetz (UrhG) als Urheber bezeichnet, und grundsätzlich stehen auch nur ihm die in §§ 15 ff. UrhG aufgezählten Verwertungsrechte zu. Stellt ein Plattformnutzer urheberrechtlich geschützte Inhalte auf eine Internetplattform ein, macht er diese öffentlich zugänglich, was eindeutig eine öffentliche Wiedergabe im Sinne der §§ 15 Abs. 2, 19a UrhG bzw. Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL darstellt. Das Recht der öffentlichen Wiedergabe steht jedoch ausschließlich dem Urheber zu. Damit kann der Urheberrechtsinhaber diesen Nutzer in Anspruch nehmen. In der Praxis treten diese Nutzer jedoch häufig unter einem Pseudonym auf, was die Rechtsdurchsetzung nahezu unmöglich macht.
Problematisch ist jedoch, ob und wie der Plattformanbieter haftet. Die gängige und damit gefestigte Rechtsprechung auf diesem Gebiet sieht den Plattformbetreiber nicht als Täter einer eigenen Handlung der öffentlichen Wiedergabe. Stellt ein Dritter Inhalte in die Plattform ein, handelt es sich für den Plattformbetreiber um fremde Informationen, sodass einige Haftungsprivilegien zu seinen Gunsten greifen können. Macht der Plattformbetreiber sich die Inhalte jedoch „zu Eigen“, also ist nach außen erkennbar, dass er die inhaltliche Verantwortung für die veröffentlichten Inhalte auf der Plattform übernommen hat, so handelt es sich um eine eigene öffentliche Wiedergabe des Betreibers der Plattform. Konsequenz dessen ist eine Haftung nach § 7 Abs. 1 Telemediengesetz (TMG) bzw. Art. 14 Abs. 1 ECRL, womit der Betreiber sich nicht mehr auf mögliche Privilegien berufen kann.
Der Sachverhalt
Anfang November 2008 waren Videos mit Musikwerken einer Sängerin auf YouTube, einer Plattform auf der kostenlos autovisuelle Beiträge eingestellt, veröffentlicht und abgerufen werden können, eingestellt worden, woraufhin der Produzent der betroffenen Künstlerin eine Schwestergesellschaft von YouTube und Google Inc. zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aufforderte. Nachdem YouTube einige dieser Videos sperrte, tauchten auf der Internetplattform Mitte November aber weitere Videos mit Tonaufnahmen der Sängerin auf.
Der Verfahrensverlauf
Im erstinstanzlichen Verfahren forderte der Produzent als Kläger von der Beklagten YouTube und Google die Unterlassung, Auskunftserteilung und eine Feststellung der Schadensersatzpflicht. Das Landgericht Hamburg (Urt. v. 03.09.2010, Az. 308 O 27/09) gab der Klage in Bezug auf drei Musiktitel statt, lehnte sie im Übrigen aber ab.
Beide Parteien legten gegen dieses Urteil Berufung ein, und landeten vor dem Oberlandesgericht Hamburg. In dem Urteil wurde die Beklagte als Störer nach § 97 Abs. 1 S. 1 UrhG eingeordnet, wonach sich ihre Haftung auf negatorische Ansprüche beschränkt. YouTube (und damit auch Google als Inhaber nach § 99 UrhG) wurde dazu verurteilt es zu unterlassen, Dritten eine öffentliche Wiedergabe in Bezug auf sieben näher bezeichneten Aufnahmen aus dem produzierten Album zu ermöglichen (OLG Hamburg, Urt. v. 1. Juli 2015, Az. 5 U 175/10) und eine Auskunft hinsichtlich der Nutzer der Plattform abzugeben. Das Gericht ordnete YouTube weder als Täter noch als Mittäter oder Teilnehmer der urheberrechtlichen Verletzungshandlung ein. Der Plattformbetreiber stellte die Inhalte nicht selber ein oder wirkte in einer urheberrechtlichen Relevanz mit den Nutzern zusammen, zudem machte sich YouTube die betroffenen Inhalte nicht zu Eigen. Eine Haftung als Störer, die das Gericht bejahte, setzt eine Verletzung von Überwachungspflichten voraus. Durch das Bereitstellen der Plattform liege ein nicht unwesentlicher Beitrag zu der Urheberrechtsverletzung vor. Außerdem hätte YouTube infolge seiner Kenntniserlangung Anfang November 2008 ausreichende Vorsorgen dafür treffen müssen, um weitere Urheberrechtsverstöße zu vermeiden. Diese Überwachungspflicht nahm das Unternehmen hinsichtlich der sieben Musiktitel jedoch nicht vor.
Nun verfolgen sowohl Kläger als auch Beklagte ihre bisherigen Anträge vor dem BGH.
Grund der Vorlage an den EuGH
Grundsätzlich hat sich die deutsche Rechtsprechung in Bezug auf die Haftung des Host-Providers hinreichend verfestigt. Unklarheiten ergaben sich für den BGH allerdings daraus, dass der europäische Gesetzgeber in einer neueren Entscheidung den Tatbestand der öffentlichen Wiedergabe in Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL um die mittelbare Wiedergabe und den Verkauf von Abspielgeräten sowie den Betrieb von Internetplattformen erweitert hat. Damit stellte sich in dem laufenden Verfahren für den BGH die Frage, ob diese Dichotomie von Täter- und Störerhaftung nach der neuen Rechtsprechung des EuGH gegen Unionsrecht verstößt. Aus diesem Grund stellt er einige Fragen zur Auslegung von Art. 3 und 8 Abs. 3 InfoSoc-RL, Art. 14 ECRL und Art. 11 und 13 Enforcement-RL zur Vorabentscheidung an den EuGH.
Die Fragen an den EuGH
Der BGH stellt dem EuGH insgesamt sechs Fragen.
Frage 1
Liegt eine „öffentliche Wiedergabe“ vor, wenn der Internetplattformbetreiber keine konkrete Kenntnis von der Verfügbarkeit urheberrechtsverletzender Inhalte hat oder wenn der Betreiber die betroffenen Inhalte löscht oder den Zugang zu ihnen unverzüglich sperrt nach Kenntniserlangung?
Das Recht der öffentlichen Wiedergabe steht nach Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL ausschließlich dem Urheber zu. Kommt es zu einer öffentlichen Wiedergabe auf einer Internetplattform durch einen seiner Nutzer, liegt folglich eine Urheberrechtsverletzung vor, womit sich die Frage der Verantwortlichkeit des Plattformbetreibers stellt. Nach der Konzeption der E-Commerce-RL wird ein Plattformbetreiber eher als ein bloßer Vermittler eingeordnet, der in einem rein technisch-passiven Verhältnis zur Nutzerinformation steht. Art. 15 Abs. 1 ECRL verdeutlicht diese Wertung, indem dem Host-Provider keine allgemeinen Überwachungspflichten wie das aktive Suchen nach rechtswidrigen Tätigkeiten auferlegt werden. Der Grund dafür sind die automatisierten Vorgänge seiner Tätigkeit, zumal es daher keine anlassunabhängigen inhaltlichen Kontrollen gibt. Im Ergebnis ist das Geschäftsmodell des Plattformbetreibers in dieser Hinsicht schützenswert, was sich dadurch auszeichnet, dass nach Art. 14 Abs. 1 ECRL eine Informationsgesellschaft, deren Tätigkeit in der Speicherung von durch seine Nutzer eingegebene Daten besteht, nicht verantwortlich ist. Dies stellt eine Haftungsprivilegierung dar. Diese greift aber nicht im Fall der tatsächlichen Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information, oder wenn der Anbieter im Falle der Kenntniserlangung nicht unverzüglich die Informationen entfernt oder den Zugang zu ihnen sperrt.
Die Frage des BGH umfasst aber nur die Konstellation, dass der Plattformbetreiber entweder keine Kenntnis hat oder aber unverzüglich tätig wurde, indem er die Informationen entfernt oder den Zugang zu ihnen sperrt. In diesem Fall greift die Haftungsprivilegierung ein, und der Plattformbetreiber ist nach Art. 14 Abs. 1 ECRL nicht als Verantwortlicher anzusehen. Daraus könnte man schließen, dass der Betreiber damit nicht als Täter im Sinne des Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL anzusehen ist. Einige Unklarheiten bereitet aber eine kürzlich vom EuGH ergangene Entscheidung (EuGH Urt. v. 017, Az. C – 610/15), in der der Betrieb einer Internetplattform als öffentliche Wiedergabe eingeordnet wurde. Konkret ging es in der Entscheidung um eine Online-Filesharing-Plattform, deren Tätigkeit einer „öffentlichen Wiedergabe“ aus dem Grund bejaht wurde, dass der Betreiber nicht lediglich die Plattform als Zugangsmittel zur Verfügung stellt, sondern auch Torrent-Dateien indexiert und erfasst, und damit den Nutzern ermöglicht, diese Werke aufzufinden und sie im Rahmen eines „Peer-to-peer“-Netzes zu teilen. Damit umfasse die Tätigkeit mehr als nur eine „bloße Bereitstellung“ von Anlagen nach Erwägungsgrund 27 der InfoSoc-RL. Mit der Bejahung der Merkmale einer „öffentlichen Wiedergabe“, die in der Abrufbarkeit des Videos für einen unbegrenzten Personenkreis und der Erreichung eines neuen Publikums bestehen, führte die Entscheidung dazu, unter Umständen auch mittelbare Wiedergabehandlungen unter den Begriff der öffentlichen Wiedergabe zu fassen. Daraus könnte eine Tendenz geschlossen werden, die im deutschen Recht angewandte Lösung der Störerhaftung durch die Lösung über die öffentliche Wiedergabe nach Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL abzulösen. Der BGH führte in den Vorlagefragen aus, dass eine öffentliche Wiedergabe mangels Kenntnis des Plattformbetreibers seiner Einschätzung nach nicht vorläge.
Nicht beantwortet bleibt eine andere durchaus spannende Konstellation: Wurde der Host-Provider in Kenntnis gesetzt oder hat selber von rechtswidrigen Tätigkeiten oder Informationen Kenntnis erlangt, so entfällt der Grund für die Haftungsprivilegierung. Fraglich ist die Konsequenz dessen: In einer neuen Rechtsprechung des EuGHs (Urt. v. 8. September 2016, Az. C – 160/15) entwickelte der EuGH ein System im Bereich der privaten Linksetzung, welche zu einem „Notice-and-take-down-Verfahren“ führt. Das bedeutet, dass spiegelbildlich zum Nichteingreifen der Haftungsprivilegierung nach Art. 14 Abs. 1 ECRL eine Verantwortlichkeit des Host-Providers nach Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL konstruiert wird. In der Konsequenz treffen diesen Verhaltenspflichten. Dieser Rückschluss ist aber nicht unproblematisch: das Nichtgreifen einer Haftungsprivilegierung führt per se nach dem Wortlaut des Gesetzes noch nicht automatisch zu einer Haftungsbegründung.
Frage 2
Fällt die Tätigkeit des Betreibers einer Internetvideoplattform, wenn die erste Frage verneint wird, in den Anwendungsbereich des Art. 14 Abs. 1 ECRL?
Hintergrund dieser Frage des BGHs ist, dass, sofern der Plattformbetreiber nicht unter Art. 14 Abs. 1 ECRL fällt, er möglicherweise nach den Vorschriften der Enforcement-RL als Verletzer auf Schadensersatz haften könnte.
Nach Art. 14 Abs. 1 ECRL ist ein Dienstanbieter, der die von einem Nutzer eingegebenen Informationen speichert, nicht als Verantwortlicher anzusehen, wenn er keine tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information oder Schadensersatzansprüchen hat oder er die Informationen unverzüglich nach Kenntniserlangung entfernt oder den Zugang zu ihnen sperrt. Die Frage des BGH umfasst genau den Fall der Unkenntnis oder des unverzüglichen Tätigwerdens bei Kenntniserlangung, jedoch legt der BGH die Frage im Hinblick auf ein Urteil des EuGHs vor, in dem dieser die Bestimmung der Richtlinie konkretisiert und eingeschränkt ausgelegt hat (EuGH Urt. v. 12.07.2011, Az. C – 324/09). Danach konnte sich ein Betreiber eines Online-Marktplatzes nicht auf die Ausnahmen von der Verantwortlichkeit des Art. 14 Abs. 1 ECRL berufen, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstände bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der betroffenen Angebote hätte feststellen müssen, und er im Falle diesen Bewusstseins nicht unverzüglich nach Art. 14 Abs. 1 lit. b) ECRL tätig geworden ist. Das verdeutlicht, dass ein Dienstanbieter sich nur dann auf die Haftungsprivilegien berufen können soll, wenn seine Tätigkeit insofern „neutral“ ist, als dass sie auf die rein technische und automatische Verarbeitung der Daten beschränkt ist. Darin bestehe gerade die Rechtfertigung der Haftungsprivilegierung. Eine „aktive Rolle“ des Anbieters hingegen lasse seine Verantwortlichkeit nicht entfallen. Nun soll der EuGH also feststellen, welche Rolle der Internetplattformbetreiber bei den konkreten Tätigkeiten spielt und wie aktiv er in die Verarbeitung der Informationen eingreift.
Frage 3
Ist es erforderlich, dass sich die tatsächliche Kenntnis von der rechtswidrigen Tätigkeit oder Information und das Bewusstsein der Tatsachen nach Art. 14 Abs. 1 ECRL auf konkrete rechtswidrige Tätigkeiten oder Informationen beziehen muss, wenn die Tätigkeit des Plattformbetreibers unter Art. 14 Abs. 1 ECRL fällt?
Bejaht der EuGH die Eröffnung des Anwendungsbereiches des Art. 14 Abs. 1 ECRL für die Tätigkeit des Plattformbetreibers, stellt sich die Frage nach den Anforderungen an die Kenntnis des Dienstanbieters, auf deren Beantwortung die Vorschrift keinerlei Hinweise gibt. Aus Art. 15 Abs. 1 ECRL ergibt sich, dass Dienstanbieter keine allgemeine Überwachungspflicht trifft und dieser damit keine präventiven Kontrollen vornehmen muss. Somit wird der Plattformbetreiber in der Praxis regelmäßig erst durch den betroffenen Rechteinhaber über die rechtswidrige Tätigkeit oder Information in Kenntnis gesetzt. Dabei könnte der Maßstab der oben genannten Rechtsprechung des EuGH vom 12.07.2011 herangezogen werden, indem beurteilt wird, ob im konkreten Fall ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der betroffenen Information hätte feststellen müssen und er dann unverzüglich nach Art. 14 Abs. 1 lit. b) ECRL tätig geworden ist. Endscheidend kommt es auf den Hinweis an, so dass beispielsweise eine Rolle spielen könnte, wie genau der Hinweis auf einen Rechtsverstoß formuliert und ob er hinreichend begründet ist. Der BGH hält in seiner Einschätzung der gestellten Vorlagefragen eine konkrete Kenntnis des Plattformbetreibers für erforderlich und argumentiert mit dem Wortlaut und dem Telos der Vorschrift. Ein Anbieter kann die Pflicht nach Art. 14 Abs. 1 lit. b) ECRL nur bezüglich konkreter Informationen erfüllen. Eine allgemeine Kenntnis wird wohl im Ergebnis nicht ausreichen, um von einem sorgfältigen Wirtschaftsteilnehmer die Entfernung oder Sperrung der Information zu fordern.
Frage 4
Vorausgesetzt die Tätigkeit des Plattformbetreibers fällt unter Art. 14 Abs. 1 ECRL, ist es mit Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-RL vereinbar, wenn der Rechtsinhaber gegen den Plattformbetreiber erst dann eine gerichtliche Anordnung erlangen kann, wenn es nach einem Hinweis auf eine klare Rechtsverletzung zu einer erneuten Rechtsverletzung dieser Art gekommen ist?
Im Wesentlichen fragt der BGH den EuGH mit dieser Frage an, ob das System der Störerhaftung mit den unionsrechtlichen Vorgaben zur Vermittlerhaftung konform ist.
In Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-RL normiert der europäische Gesetzgeber eine Sicherstellungspflicht der Mitgliedstaaten, dass die Rechteinhaber gerichtliche Anordnungen gegen Vermittler beantragen können, deren Dienste von einem Dritten zur Verletzung eines Urheberrechts oder verwandter Schutzrechte genutzt werden. Erwägungsgrund 59 InfoSoc-RL legt den Mitgliedstaaten nahe, die Bedingungen und Modalitäten für die jeweiligen gerichtlichen Anordnungen zu regeln. Damit steht den Mitgliedstaaten ein eigener Regelungsbereich zu Verfügung, der jedoch durch bindende europäische Mindeststandards im Rahmen der Europäisierung der Vermittlerhaftung eingeschränkt ist. Die Intention dieser Mindeststandards ist eine nicht zu weite Entfernung der nationalen Umsetzungsgesetze von den europäischen Vorgaben zur Gewährleistung der Effektivität des Unionsrechts im Einklang mit dem Zweck der Richtlinienbestimmungen zur Vermittlerhaftung.
Der BGH ist der Meinung, dass einem Rechtsinhaber ein Anspruch auf Unterlassung erst zustehen kann, wenn es nach einem Hinweis auf einer Rechtsverletzung erneut zu einer gleichartigen Rechtsverletzung gekommen ist. Diese Ansicht vertritt er seit der Stiftparfüm-Entscheidung (BGH Urt. v. 17.08.2011, Az. I ZR 57/09). Die Haftung als Störer setzt die Verletzung von Verhaltenspflichten voraus, die beim Störer jedoch erst mit einer zweiten Rechtsverletzung vorliege. Mangels allgemeiner Überwachungspflichten (vgl. Art. 15 Abs. 1 ECRL) entsteht seine Verhaltenspflicht erst mit dem Zeitpunkt seiner Inkenntnissetzung von einer stattgefundenen Rechtsverletzung, so dass ein Plattformbetreiber diese Pflicht erst mit dem nicht unverzüglichen Tätigwerden bei einer weiteren derartigen Rechtsverletzung verletzt, indem er den rechtsverletzenden Inhalt nicht entfernt oder den Zugang zu ihm gesperrt hat oder Vorsorge getroffen hat, dass es künftig nicht zu einer derartigen Rechtsverletzung kommt.
Gegen die Europarechtskonformität der Störerhaftung spricht jedoch einiges. Dazu gehört zum einen, dass ein Unterlassungsanspruch des Rechteinhabers im Rahmen der Störerhaftung nicht der Begrenzung einer doppelten Haftungsvoraussetzung unterworfen werden sollte. Mit dem Erfordernis einer Doppelrechtsverletzung unterliegt das nationale Haftungssystem mehr Haftungsvoraussetzungen, die das europäische Haftungssystem gerade nicht vorsieht. Zudem kritisiert die Literatur die Unterschiedlichkeit der in Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-RL bezweckten und der praktizierten deutschen Konzeption der Haftung. Eine Vermittlerhaftung sei gerade nicht wie im deliktischen Verständnis auf einen Verhaltensvorwurf zurückzuführen, sondern basiere auch einer Verhaltenspflicht aus der Stellung als hilfeleistungspflichtiger Vermittler. Damit seien die Verhaltenspflichten infolge der Kenntnis des Plattformanbieters als Voraussetzung einer Störerhaftung auf Rechtsfolgenseite anzusiedeln. Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-RL setzt gerade, anders als die Haftung des Verletzers, keine Pflichtverletzung voraus, sondern könne auch auf Vermittler angewandt werden. Im Ergebnis können beide Ansichten mit guten Argumenten gestützt werden, womit abzuwarten bleibt, ob der EuGH zur Entwicklung eines einheitlichen europäischen Haftungssystems tendiert und nationalrechtliche Spielräume durch Verneinung dieser Vorlagefrage eingrenzt.
Frage 5
Ist ein Plattformbetreiber als Verletzer im Sinne des Art. 11 S. 1 und Art. 13 Enforcement-RL anzusehen, wenn er weder eine öffentliche Wiedergabe vornimmt, noch unter Art. 14 Abs. 1 ECRL fällt?
Art. 11 S. 1 Enforcement-RL legt den Mitgliedstaaten die Pflicht der Sicherstellung auf, dass die zuständigen Gerichte Anordnungen der Untersagung weiterer Verletzungen gegen den Verletzer eines Rechts des geistigen Eigentums erlassen können. Zudem müssen die Gerichte auf Antrag der geschädigten Partei anordnen können, der Verletzer habe dem Rechteinhaber zum Ausgleich des von ersterem wegen der Rechtsverletzung erlittenen tatsächlichen Schadens angemessenen Schadensersatz zu leisten, wenn der Verletzer wusste oder hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, Art. 13 Abs. 1 Enforcement-RL.
Die Enforcement-RL unterscheidet bezüglich der Inanspruchnahme von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums zwischen einem Verletzer und einer Mittelsperson. Mittelspersonen nach der Enforcement-RL werden nach Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-RL als Vermittler und nach Art. 14 Abs. Abs. 3 ECRL als Diensteanbieter bezeichnet. Ein Verletzer haftet nach Art. 11 S. 1 Enforcement-RL, § 97 Abs. 1 UrhG auf Unterlassung, nach Art. 13 Abs. 1 Enforcement-RL, § 97 Abs. 2 UrhG auf Zahlung von Schadensersatz und nach Art. 13 Abs. 2 Enforcement-RL, § 102a UrhG, § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 BGB auf Herausgabe der Gewinne. Eine Mittelsperson kann sich dagegen auf die Haftungsprivilegierung des Art. 14 Abs. 1 lit. a oder b ECRL berufen, und haftet in diesem Fall gar nicht. Sofern die Voraussetzungen der Haftungsprivilegien nicht erfüllt sind, haftet die Mittelsperson wie ein Verletzer.
Der Plattformbetreiber YouTube ist an der Verletzungshandlung dadurch beteiligt, dass er die Plattform überhaupt zur Verfügung stellt. Aus diesem Grund geht der BGH in seiner Einschätzung davon aus, dass der Plattformbetreiber entweder Verletzer oder Mittelsperson sein muss. Der Vergleich zwischen Art. 11 S. 1 und S. 3 Enforcement-RL verdeutlicht, dass einem Verletzer die weitere Verletzung eines Rechts untersagt werden kann; er nimmt also eine eigene Verletzungshandlung vor, deren Fortsetzung ihm verboten werden soll. Soll ein Host-Provider weitere Rechtsverletzungen unterlassen, muss er aktiv werden, um eine effektive Prävention zu erreichen. Nach Auffassung des BGH kann ein Verletzer nicht nur der Nutzer selbst sein, sondern auch ein Diensteanbieter, der bei der öffentlichen Wiedergabe durch Nutzer seiner Plattform eine aktive Rolle spielt. Schreibt man dem Plattformbetreiber als Diensteanbieter aber eine aktive Rolle zu, führt das im Ergebnis zwar zu einem Entfallen der Haftungsprivilegien des Art. 14 ECRL, bedeutet aber nicht automatisch eine Haftungsbegründung als Verletzer.
Dennoch ließe sich eine Verletzerhaftung mit überzeugenden Argumenten begründen: Auf einen Dienstanbieter mit aktiver Rolle, der sich nicht auf die Haftungsprivilegien des Art. 14 Abs. 1 ECRL berufen kann, findet auch die Erleichterung des Art. 15 Abs. 1 ECRL mit der Erleichterung hinsichtlich einer eigenen allgemeinen Überwachungspflicht keine Anwendung. In der Folge treffen den Plattformbetreiber proaktive Prüfpflichten in Bezug auf die Informationen, hinsichtlich derer er eine aktive Rolle einnimmt. Damit ließe sich eine Grundlage für seine Haftung mit der Verletzung einer Verkehrspflicht konstruieren, dass der Plattformbetreiber sich selbst keine Kenntnis von der Rechtsverletzung verschafft hat. Seine aktive Rolle verbunden mit dem Entfallen der Erleichterung des Art. 15 Abs. 1 ECRL führt seinerseits somit zur Begründung einer Verkehrspflicht und damit zu einer Haftungsgrundlage bei einem Verstoß gegen diese Verkehrspflicht. Dieses Ergebnis kann jedoch nicht zwingend für diese Konstruktion sein, zumal es auf die Tätigkeiten des Diensteanbieters im Einzelfall ankommt und die Grauzone, dass ein aktiver Vermittler sich nicht auf die Haftungsprivilegien des Art. 14 ECRL berufen kann, jedoch auch kein Täter ist, unionsrechtlich bislang nicht geregelt ist.
Frage 6
Vorausgesetzt der Plattformbetreiber ist als Verletzer im Sinne des Art. 11 S. 1 und Art. 13 Enforcement-RL anzusehen, darf seine Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz nach Art. 13 Abs. 1 Enforcement-RL davon abhängig gemacht werden, dass der Verletzer sowohl in Bezug auf seine eigene Verletzungshandlung als auch in Bezug auf die Verletzungshandlung des Dritten vorsätzlich gehandelt hat und wusste, oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass Nutzer die Plattform für konkrete Rechtsverletzungen nutzen?
Nach der deutschen Rechtlage ist, angelehnt an die Regelungen im Strafrecht, eine Haftung als Täter oder Teilnehmer möglich. Mangels gemeinschaftlicher Begehung der Rechtsverletzung scheidet eine Haftung als Mittäter (§ 25 Abs. 2 StGB) aus, sodass lediglich eine Haftung des Vermittlers als Teilnehmer nach § 830 Abs. 2 BGB in Betracht kommt. Eine Teilnehmerhaftung unterliegt nach deutscher Rechtslage dem strengen Erfordernis eines Doppelvorsatzes. Das bedeutet, dass der Teilnehmer sowohl auf seine Teilnahmehandlung als auch die konkrete Haupttat und ihre Rechtswidrigkeit zumindest bedingten Vorsatz haben muss.
Nach Art. 13 Abs. 1 Enforcement-RL haftet der Verletzer, der wusste oder vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass er eine Verletzungshandlung vornahm, dem Rechtsinhaber auf Schadensersatz. Hier zeigt sich, dass die Vorschrift einerseits eine fahrlässige Beihilfe anerkennt, andererseits jedoch für die Mitgliedstaaten eine Pflicht zur nationalen Regelung und damit einen Umsetzungsspielraum gewährleistet.
Angelehnt an ein vereinheitlichtes europäisches Haftungssystem könnte der EuGH sich für die Pflicht der Anerkennung einer fahrlässigen Gehilfenhaftung aussprechen. Es ist ohnehin fragwürdig, dass die zivilrechtliche Haftung hier auf das Strafrecht zurückgreift und somit einen Doppelvorsatz fordert. Abgesehen von der Frage nach dem erforderlichen Grad an Fahrlässigkeit für eine Haftungsbegründung, bei der der BGH einen Bezug zur konkreten Haupttat fordert, zeigen sich jedoch Wertungsprobleme, sollte der EuGH sich für eine fahrlässige Gehilfenhaftung aussprechen: Im Ergebnis würde dann ein Dienstanbieter, der eine aktive Rolle einnimmt, strenger haften, als ein Dienstanbieter, der eine neutrale Rolle hat, sich somit auf die Privilegien des Art. 14 ECRL stützen kann und der nur bei Bewusstsein von den Tatsachen oder Umständen, aus denen die rechtswidrige Tätigkeit oder Information offensichtlich wird, haftet.
Auswirkungen dieser Vorlagefragen
Nach den bisherigen Grundsätzen des deutschen Rechts wäre YouTube nicht als Täterin einer Urheberrechtsverletzung anzusehen. Sie hatte die betroffenen urheberrechtswidrigen Videos weder auf die Plattform geladen, noch hatte sie sich die fremden Inhalte zu Eigen gemacht. Für eine Haftung als Teilnehmerin fehlte es an einem dafür erforderlichen Vorsatz in Bezug auf die rechtswidrige Haupttat. Damit unterlag YouTube lediglich der Pflicht, die entsprechenden Videos auf einen Hinweis hin zu sperren und vorsorglich weitere gleichartige Verletzungen zu vermeiden. Ein Verstoß gegen diese Verkehrssicherungspflicht würde danach einen Unterlassungsanspruch des Urhebers begründen, aber keinen Schadensersatzanspruch. Diese deutsche Rechtslage könnte aufgrund der neuen Rechtsprechung des EuGH nicht mehr mit dem Unionsrecht vereinbar sein.
Mit der Vorlage dieser Fragen des BGH an den EuGH wird nun das komplette System der urheberrechtlichen Störerhaftung auf den Prüfstand gestellt. Es ist möglich, dass der EuGH die Grundlagen der Störerhaftung vernichtet. Die Entscheidung des EuGH und des BGH wird sich nach der heutigen Rechtslage richten, jedoch könnten die Fragen an den EuGH im Ergebnis zu einer künftigen Dreiteilung führen, die sich in eine täterschaftliche Haftung für unmittelbare Wiedergabehandlungen, einer täterschaftlichen Haftung für mittelbare Wiedergabehandlungen ab Kenntnis oder Verletzung einer Verkehrspflicht und einer Gehilfenhaftung für Intermediäre bei einer ihnen zumutbaren und möglichen Hilfe einteilen lässt.
Momentan befindet sich das europäische Urheberrecht jedoch in einem Umbruch: Nach dem derzeitigen Vorschlag der Reform haften Plattformen künftig generell für die von ihren Nutzern eingestellten Inhalte. Zur Überprüfung der Inhalte soll es zum Einsatz sogenannter Upload-Filter kommen, die die Inhalte wie Musik, Videos oder Bilder direkt bei dem Hochladen auf Urheberrechtsverletzungen untersuchen.