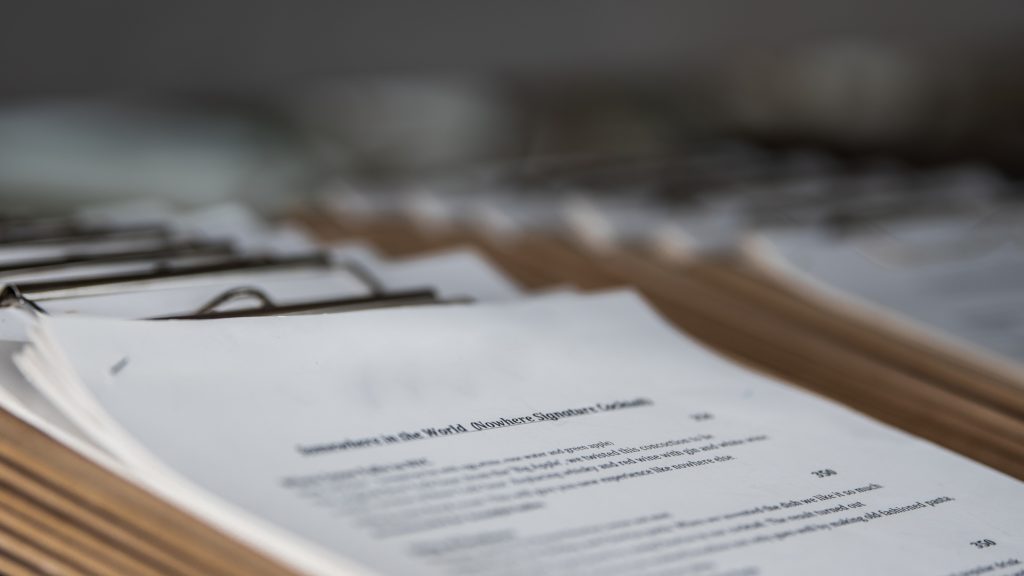MoPeG: Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts

Einführung
Das teilweise aus dem 19. Jahrhundert stammende Personengesellschaftsrecht für GbR, OHG und KG soll endlich an die Bedürfnisse des modernen Wirtschaftslebens angepasst werden, wie es auch längst schon in der Praxis umgesetzt wird. Vor allem die GbR erfährt im neuen Gesetz zahlreiche Änderungen.
Das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) tritt zum 01. Januar 2024 in Kraft.
Reformen der GbR
Die GbR selbst wird rechtsfähig
Während nach formellem Recht bislang nur die Gesellschafter einer GbR rechtsfähig waren, ist es nun die GbR selbst. Damit entfällt der Verweis auf die Vorschriften zur OHG, was der GbR sofort einen neuen Status als Grundform verschafft. Während sie nämlich bisher nur als eine dem Umstand geschuldete Gelegenheitsgesellschaft angesehen wurde, sobald sich mind. 2 Menschen für ein gewerbliches Projekt zusammentun, kann sie nun auch auf Dauer am wirtschaftlichen Leben mit all seinen Rechtsmöglichkeiten teilnehmen.
Die GbR ist Vermögensträgerin
Auch hier waren formal rechtlich bislang die einzelnen Gesellschafter die Vermögensträger. Nun ist die GbR selbst die Trägerin ihres Vermögens.
Freiberufler können sich zu einer Personenhandelsgesellschaft zusammenschließen
Über diese gesetzliche Rückendeckung dürften sich alle Freiberufler wie Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten oder Ingenieure freuen, denn sie profitieren damit von Haftungsbeschränkungen, die ihnen vorher verwehrt wurden.
Der Grund liegt in dem erweiterten Verständnis, dass der Handel mit Dienstleistungen wie ein Handel mit Waren betrachtet werden kann. Bislang berechtigte nämlich allein der Handel mit Waren zur Gründung einer Kommanditgesellschaft (KG), deren Haftungsbeschränkungen weit über die einer sog. Partnerschaftsgesellschaft hinausgehen. So haften etwa Kommanditisten unabhängig vom Sachverhalt lediglich auf die Höhe ihrer Einlagen.
Das bedeutet, dass auch Freiberufler, die sich zu einer KG zusammenschließen, als Kommanditisten künftig eine generelle Haftungsbeschränkung im Rahmen einer Personenhandelsgesellschaft genießen können, wie es bereits in vielen anderen Ländern gängige Praxis ist.
Freies Sitzwahlrecht
Künftig kann eine deutsche Personengesellschaft sämtlichen Tätigkeiten im Ausland nachgehen und dennoch in der Rechtsform einer deutschen Gesellschaft bleiben. Das freie Sitzwahlrecht für eingetragene Personengesellschaften gilt dann unabhängig vom Ort der Eintragung. Folglich besteht die freie Wahl des Verwaltungssitzes, sofern ein Vertragssitz im Inland angegeben wurde.
Der Gesellschafter scheidet aus, aber die GbR bleibt
Tod und Kündigung eines GbR-Gesellschafters führt ab 2024 per Gesetz auch nur zu dessen Ausscheiden und nicht wie bisher zur Auflösung der Gesellschaft. Die enge persönliche Bindung zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern wird dadurch abgemildert.
Beschlussmängelrecht: Wo kein Kläger, da kein Richter mehr
Für die Personenhandelsgesellschaften wie OHG und KG wird außerdem ein sog. Beschlussmängelrecht verankert. Das bedeutet, dass fehlerhafte Gesellschafterbeschlüsse nicht mehr automatisch unwirksam sind. Sie müssen nun aktiv innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe angefochten werden.
Einführung eines öffentlich einsehbaren Gesellschaftsregisters
Diese Modernisierung ist die wohl wichtigste Neuerung im MoPeG, denn Vor- und Nachteile liegen hier eng beieinander.
Mit dem MoPeG wird ein Gesellschaftsregister eingeführt, welches von den Amtsgerichten geführt wird. Öffentlich einsehbar werden dann der Name der GbR, deren Sitz, alle Gesellschafter und die Vertretungsbefugnisse.
Anders als bei OHG und KG besteht für die GbR grundsätzlich kein Eintragungszwang. Auch ohne Eintragung bleibt die GbR rechtsfähig (vgl. § 707 Abs. 1 BGB n.F.). Die Gesellschafter können frei entscheiden, ob sie die Gesellschaft eintragen möchten oder nicht.
Dennoch gibt es eine Art „faktischen Zwang“, denn in Zukunft soll nur eine eingetragene GbR das Recht haben, registrierte Rechte erwerben zu können, wie z.B. Immobilien.
Für die GbRs, die bereits vor der Gesetzesänderung nach gängiger Praxis eine Immobilie oder ein Grundstück erworben haben, greift eine Grundbuchsperre. Sie können ohne Eintragung ins Gesellschaftsregister ihre Immobilie nicht mehr veräußern, sprich: sie können nicht mehr aus dem Grundbuch ausgetragen werden.
Zu den registrierten Rechten, die eine Eintragung in das Gesellschaftsregister notwendig machen, gehören ebenfalls der Erwerb von Marken, Patenten, Gebrauchsmustern, Designs oder sonstige in öffentliche Register eingetragene Rechte.
Mehr Transparenz
Das Gesellschaftsregister ist im Aufbau und in der Funktion dem Handelsregister ähnlich. Die Publizitätsdefizite der GbR werden behoben, die klare Transparenz in Haftung und Vertretungsverhältnisse schaffen vertrauenserweckende Rechtsklarheit. Da die Informationen im Gesellschaftsregister guten Glauben genießen, kann sich der Rechtsverkehr auf die Angaben im Register verlassen.
Um genau diesen Vertrauensbonus zu schützen, kann die eingetragene GbR nur bei vollständiger Auflösung wieder aus dem Register gelöscht werden. Die Gesellschafter können die GbR also nicht einfach aus dem Register löschen lassen, ohne dass diese damit als aufgelöst gilt.
Sobald eine GbR ins Gesellschaftsregister eingetragen ist, ist sie dazu verpflichtet, dies in ihrem Namen zu kennzeichnen. Dies erfolgt durch den Zusatz eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts, oder kurz eGbR. Zudem muss sie die wirtschaftlich Berechtigten im Sinne von § 3 Abs.1 Geldwäschegesetz an das 2017 eingeführte Transparenzregister melden.
Die Eintragung ist mit Kosten verbunden.
Fazit
Mit Inkrafttreten des MoPeG wird die GbR als Außengesellschaft grundlegend neu geregelt – allerdings ändert sich im Vergleich zu der derzeitigen Praxis nur zum Teil etwas, weil größtenteils die bisherige die GbR-betreffende Rechtsprechung nur zusammengefasst wurde.
Die Eintragung ins Gesellschaftsregister stellt jedoch eine große Veränderung im MoPeG dar, die einige Vorteile bietet, aber auch einige bedenkenswerte Nachteile enthält.
Auf der einen Seite schafft die Eintragung ins Gesellschaftsregister eine Vertrauensbasis oder auch sogar erst eine Voraussetzung für intensive Rechtsgeschäfte, ist die GbR aber erst einmal eingetragen, kann sie nicht mehr aus dem Gesellschaftsregister gelöscht werden, es sei denn, die Gesellschaft wird vollständig aufgelöst (§ 707a Abs. 4 BGB n.F.). Erfordert der Zweck der GbR wirklich eine Eintragung?
Die Kehrseite der Eintragung ist nämlich eben diese Transparenz, die jedem Einblicke gewährt, wer die mit vollem Namen, Geburtsdatum und Wohnsitz genannten Gesellschafter sind, die vielleicht nicht öffentlich bekannt werden wollen oder wer zu welchen Anteilen beteiligt ist. Da die GbR Inhaberin der registrierten Rechte ist (Immobilien, Patente, Designs etc.), gilt es zu überlegen, ob sich die gewählte Gesellschaftsform, die eGbR, mit den sonstigen Bedürfnissen wie z.B. Privatsphäre verträgt oder ob eine andere Rechtsform an der Stelle nicht besser wäre.
Zu diesen Fragen beraten wir Sie gerne ausführlich und prüfen dabei Ihre Gesellschaftsverträge, ob sie ggf. angepasst werden sollten. Wir empfehlen Ihnen, dies noch vor Inkrafttreten bzw. vor Eintragung zu tun, vor allem, wenn absehbar sein sollte, dass sich der Gesellschafterbestand ändern wird.
Ihr Ansprechpartner für (gesellschaftliche) Vertragsgestaltung: RA Nicolas Golliart