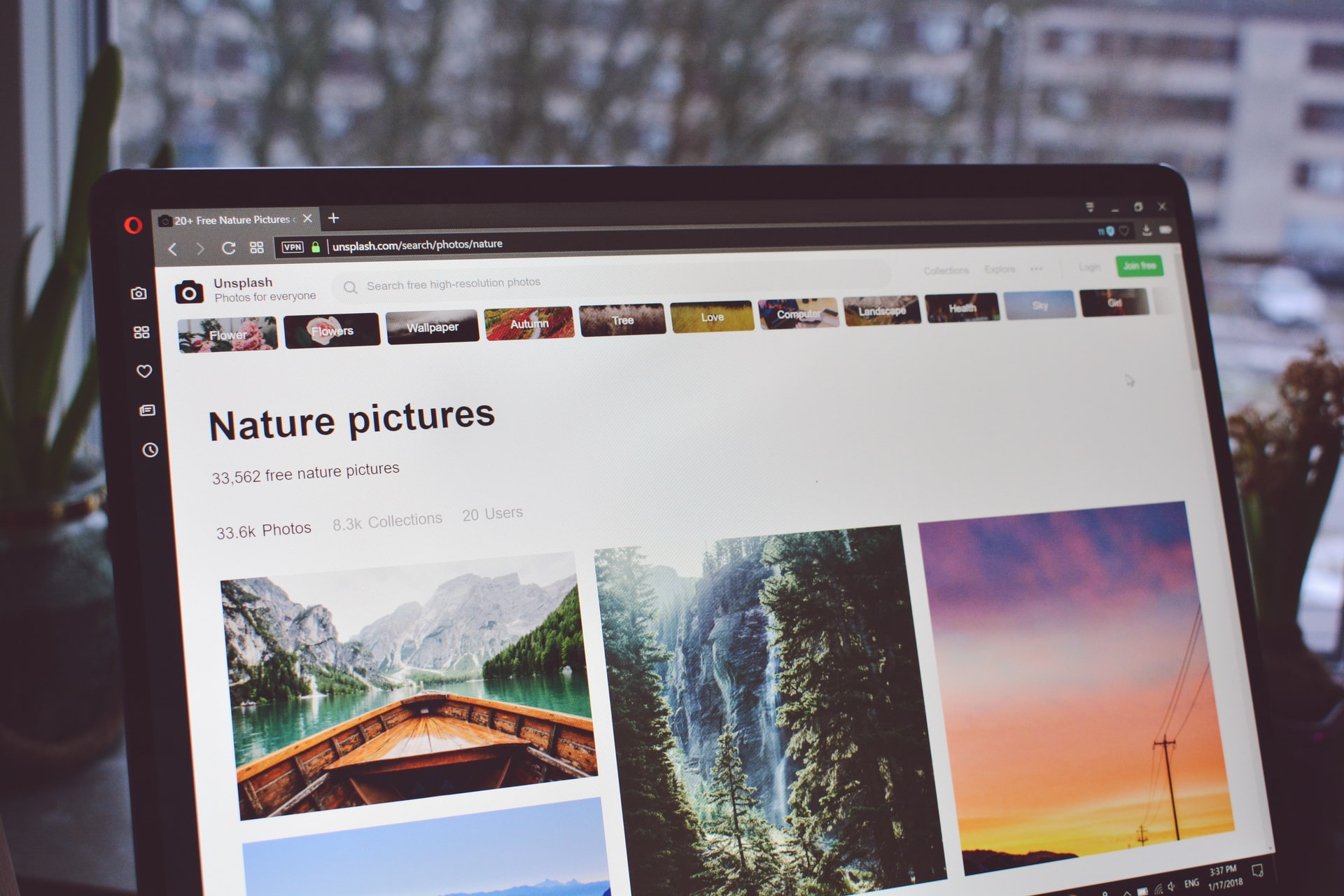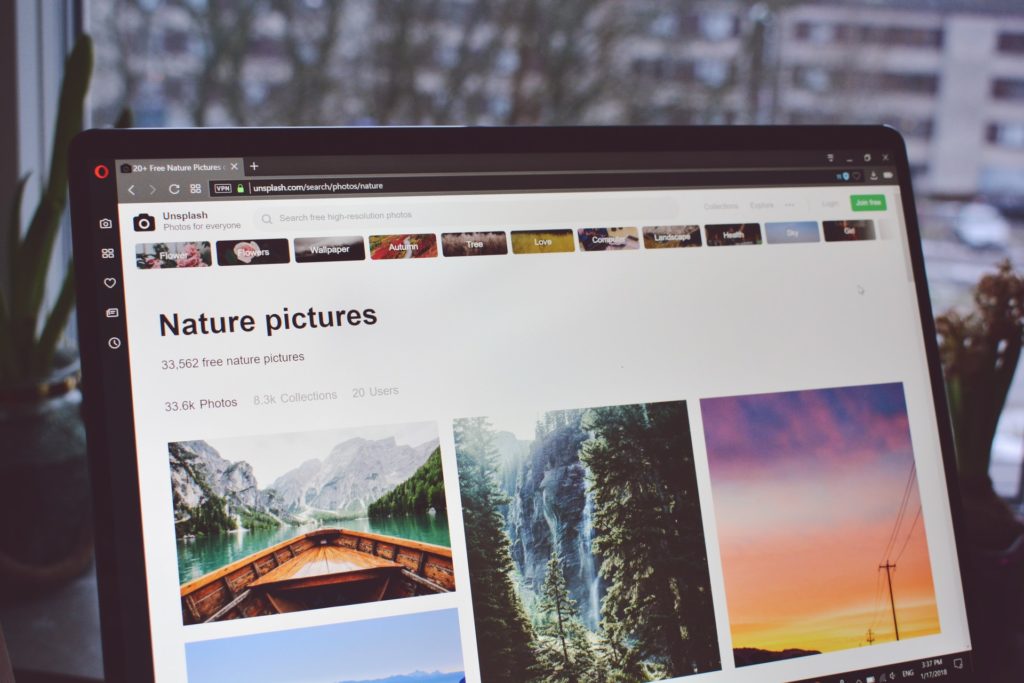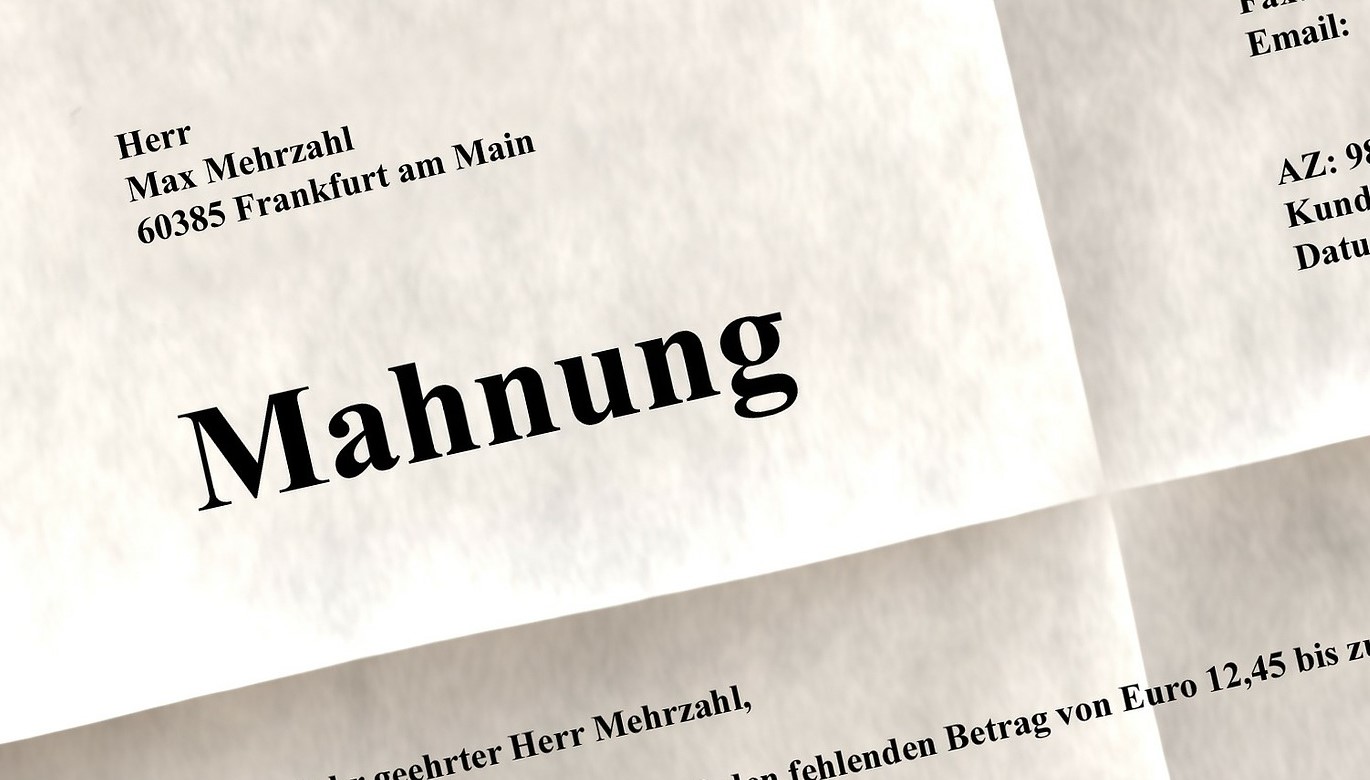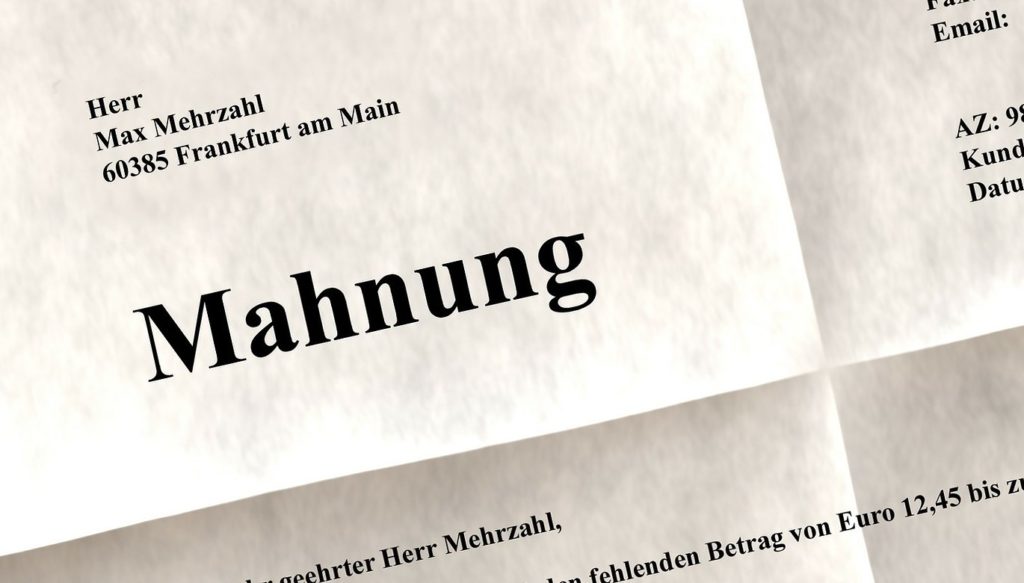Einführung
Die UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) hat sich in den letzten Jahren zum wichtigsten außergerichtlichen Verfahren zur Lösung von Domainnamenskonflikten etabliert. 1999 wurde das alternative Streitbeilegungsverfahren von der ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) geschaffen und sollte ein vereinfachtes Streitbeilegungsverfahren bei Domainstreitigkeiten als schnellere und günstigere Alternative zu Verfahren im Rahmen der ordentlichen Gerichtsbarkeit darstellen. Weiterer Beweggrund für die Einführung der UDRP war die teilweise sehr komplizierte Konstellation der beteiligten Parteien bei einem Domainnamensstreit. Wenn Domaininhaber, Beschwerdeführer und Registrar international verstreut in unterschiedlichen Ländern sitzen, kann zum einen schon die Klärung des Gerichtsstands und des anzuwendenden Rechts komplex sein kann. Zum anderen würde auch die Vollstreckung eines Urteils in einem Dritten Land die Parteien vor Probleme stellen. Unter der vor diesem Hintergrund etablierten UDRP wurden seit 1999 schon mehr als 20.700 Verfahren entschieden.
Anwendbarkeit und Anerkennung
Die ICANN hat vier unterschiedliche Organisationen als Beschwerdestellen akkreditiert. Diese sind zum einen das Asian Domain Name Dispute Resolution Center (ADNDRC), das Czech Arbitration Court Arbitration Center for Internet Disputes (CAC), das National Arbitration Forum (NAF) und die World Intellectual Property Organization (WIPO), wobei bei der WIPO der Großteil aller Beschwerden eingeht. Entschieden werden die Streitigkeiten von Panels, die sich aus 1 bis 3 Panelists zusammensetzen. Panelists sind meist im internationalen Markenrecht qualifizierte Rechtsanwälte, Professoren oder Richter, die auf einer Liste der Beschwerdestellen akkreditiert sind. Anwendbar ist das UDRP Verfahren nur auf Domainnamen, die im Bereich der sog. Generischen Top-Level-Domains (gTLDS) wie zum Beispiel „.com“, „.info“, „.net“ und „.org“. Aber auch für die country code Domains (ccTLDs) können die jeweiligen Vergabestellen sich freiwillig der UDRP unterwerfen und sie in ihrer Registrierungsordnung für die Domaininhaber verbindlich machen. So haben es bereits die Schweiz, Frankreich Spanien, Australien und noch etwa 65 weitere Länder gemacht. Da die UDRP kein zwischenstaatlicher Vertrag oder allgemeingültiges Gesetz ist, muss sie rechtsgeschäftlich anerkannt werden. Verbindliche Anerkennung erhält sie nicht erst mit einem Schiedsvertrag zwischen den Streitparteien, sondern grundsätzlich bereits mit Abschluss des Registrierungsvertrages zwischen dem beauftragten Registrar und dem Domainanmelder. Alle bei ICANN akkreditierten Registrare sind ihrerseits dazu verpflichtet, die UDRP in die Registrierungsverträge miteinzubeziehen.
Verfahrensablauf
Für den Verfahrensablauf maßgeblich sind neben den „Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy“ auch die von der jeweiligen Beschwerdestelle erlassenen „Supplemental Rules for Uniform Domain Name Resolution Policy“. Bei zu Grundelegung der Supplement Rules der WIPO sieht das Verfahren wie folgt aus: Nach der schriftlichen und elektronischen Einreichung der Beschwerde mit dem in § 3 (b) UDRP vorgesehenen Inhalt, bestätigt der ausgewählte „Dispute Resolution Provider“ den Eingang der Beschwerde innerhalb eines Tages und fordert den Registrar auf, die vom Beschwerdeführer gemachten Angaben zum Beschwerdegegner und Domainnamen zu bestätigen. Innerhalb der darauffolgenden 3 Tage, nimmt die Beschwerdestelle eine formelle Überprüfung der Beschwerde vor. Sie überprüft die Beschwerde auf ihre formelle Übereinstimmung mit den Bestimmungen der UDRP, der UDRP-Rules sowie den entsprechenden Supplement Rules und leitet sie im Falle der Ordnungsmäßigkeit an den Beschwerdegegner weiter. Damit ist das Verfahren formell eröffnet. Der Beschwerdeführer hat dann 20 Tage Zeit zu den Erklärungen und Behauptungen in der Beschwerde Stellung zu nehmen und zu begründen, warum er zur Registrierung und Benutzung des streitgegenständlichen Domainnamens berechtigt sei. Weiterhin muss die Beschwerdeerwiderung die in § 5 UDRP-Rules vorgesehenen Angaben erhalten. Ist die Beschwerdeerwiderung form-. und fristgerecht eingereicht worden, wird anschließend das Panel bestellt. Wenn keine der beiden beteiligten Parteien die Entscheidung durch 3 Personen im Panel beantragt hat, ernennt die Beschwerdestelle eine Einzelperson aus der von ihm geführten Liste spätestens nach 5 Tagen. Die Parteien können aber auch zu diesem Zeitpunkt noch eine Entscheidung durch ein Dreier-Panel beantragen. Dann wählt die Beschwerdestelle jeweils eine Person aus, die die beteiligten Parteien vorgeschlagen haben. Für die Dritte Person können die Parteien Präferenzen auf einer Liste von 5 Kandidaten angeben, die die Beschwerdestelle vorgeschlagen hat. Von diesen präferierten Personen sucht die Beschwerdestelle wiederum eine Einzelperson als dritten Panelist aus. Für dieses Verfahren stehen 15 Tage zur Verfügung. Innerhalb der nächsten 14 Tage muss das Schiedsgericht eine Entscheidung fällen, die nach spätestens 3 Tagen an den Registrar, ICANN und den Beschwerdegegner mitgeteilt wird. Diese Entscheidung wird von dem für den Domainnamen zuständigen Registrar anschließend umgesetzt, wenn nicht der Beschwerdegegner oder Beschwerdeführer innerhalb von 10 Tagen gemäß § 4 (k) UDRP Klage bei einem ordentlichen Gericht einreicht. Damit wird bewirkt, dass die Durchsetzung im alternativen Streitbeilegungsverfahren ausgesetzt und durch das Verfahren im ordentlichen Rechtsweg verdrängt wird. Mit diesem Verfahrensablauf wird die Dauer eines Streitbeilegungsprozesses auf etwa 2 Monate begrenzt.
Materielle Rechtsvoraussetzungen
Die materiell-rechtlichen Voraussetzungen der UDRP sind so zugeschnitten, dass nur Verletzungstatbestände der bösgläubigen Domainregistrierung erfasst werden. § 4 (a) UDRP enthält die folgenden 3 Voraussetzungen, die im Wege einer Stufenprüfung kumulativ vorliegen müssen, um einen geltend gemachten Übertragungs- und Löschungsanspruch zu begründen.
- Der Beschwerdeführer muss erklären, dass der betroffene Domainname mit einer Handels- oder Dienstleistungsmarke, an welcher er Rechte hat, identisch oder täuschend ähnlich ist;
- Der Domaininhaber selbst hat kein Recht oder berechtigtes Interesse in Bezug auf den Domainnamen;
- Und der Domainname wurde bösgläubig registriert und verwendet.
Zu den jeweiligen Tatbestandsvoraussetzungen ist in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Rechtsprechung ergangen, dennoch sind die Bestimmungen autonom auszulegen. Weder die Rechtsprechung nationaler Rechtsordnungen noch frühere Panelentscheidungen können hier direkte Bindungswirkung entfalten. Trotzdem ist eine Bezugnahme auf die Judikatur nationaler Rechtsprechung bei vergleichbarer Rechtsfrage möglich.
Schutzfähige Marke
Grundvoraussetzung für die Geltendmachung eines Übertragungs- oder Löschungsanspruches nach § 4 (a) UDRP ist der Nachweis einer geschützten Marke. Darunter fallen allerdings nicht Marken, die zwar angemeldet, aber noch nicht eingetragen sind. Umstritten ist die Frage nach dem maßgeblichen Zeitpunkt des Markenschutzes. Ein Teil geht davon aus, dass die Marke vor dem Domainnamen registriert sein muss, da sonst der im Markenrecht geltende Prioritätsgrundsatz unterlaufen würde und ein prioritätsjüngerer Markeninhaber gegen einen älteren Domaininhaber vorgehen könnte. Demgegenüber scheint es jedoch zutreffender den Zeitpunkt für das Erfordernis des § 4 (a) (i) UDRP für unerheblich zu erachten und ihm lediglich im Rahmen der Bösgläubigkeit Bedeutung beizumessen: Denn wer eine Domain registriert, die den Namen einer Marke trägt, die es im Registrierungszeitpunkt noch gar nicht gab, dem kann kein Bösgläubigkeitsvorwurf gemacht werden. Im Gegensatz zu den Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung, setzt die UDRP nicht voraus, dass die Marke, in dem Land geschützt ist, in dem auch der Domainname registriert wurde, da die Nutzung des Internets nicht durch territoriale Grenzen beschränkt ist und die Markeneintragung in bestimmten Ländern im Vergleich zu Domainnamensstreitigkeiten eine relativ geringe Relevanz hat, insbesondere wenn es sich um eine „.com“-Domain handelt.
In eigenes Recht oder berechtigtes Interesse
Der Domaininhaber darf kein eigenes Recht oder berechtigtes Interesse an dem Domainnamen haben, was der Beschwerdeführer zu beweisen hat. Dazu führt § 4 ( c ) UDRP 3 Umstände auf, die als Beweis für ein Recht oder berechtigtes Interesse dienen können. Ein Recht oder berechtigtes Interesse wird unter anderem dann vermutet, 1) wenn der Domaininhaber den Domainnamen oder einen diesem entsprechenden Namen vor Anzeige der Streitigkeit für ein gutgläubiges Angebot von Waren oder Dienstleistungen verwendet oder eine solche Verwendung vorbereitet hat. Weiterhin kann ihm auch ein Recht bzw berechtigtes Interesse zu stehen, 2) wenn er allgemein unter dem Domainnamen bekannt ist, selbst wenn er eine Marke diesen Namens nicht erworben hat oder 3) er den Domainnamen in berechtigter nichtgewerblicher oder sonst anerkennenswerter Weise ohne Gewinnerzielungsabsicht und ohne den Willen, Verbraucher in irreführender Weise abzuwehren oder die fragliche Marke zu verunglimpfen, verwendet. Ein Recht im Sinne der Vorschrift stellt auf jeden Fall ein Kennzeichenrecht (Unternehmensbezeichnung, Werktitel etc) dar, auf das sich der Domaininhaber berufen kann, unabhängig davon, ob sich das Kennzeichenrecht auf das gesamte Staatsgebiet des Schutzlandes erstreckt oder regional begrenzt ist. Dies gilt jedoch nicht für den Erwerb von Kennzeichenrechten nach Kenntnis der bevorstehenden Beschwerde oder einer Markenregistrierung in Missbrauchsabsicht. Eine solche Absicht kann sich darin äußern, dass der Eintragende es auf eine Rufausbeutung abgesehen hatte oder die Eintragung mit dem Zweck erfolgt ist, den Domainnamen gegen Ansprüche des Markeninhabers zu schützen bzw. ihm den Domainnamen im Nachhinein unter erhöhten Kosten zu übertragen. Die Aufzählung in § 4 (c ) UDRP ist beispielhaft und nicht abschließend, so dass die Beschwerde-Panels den vergangenen Jahren in zahlreichen Fällen auch ein Recht oder berechtigtes Interesse begründen konnten, ohne auf die Gründe des § 4 ( c ) UDRP zurückzugreifen. Die größte Fallgruppe stellt dabei die Benutzung von Domainnamen mit beschreibendem Sinngehalt dar, sodass in den Fällen der Domainnamen „dogs.com“, „lawcheck.com“ und „golfsociety.com“, dem Domaininhaber ein berechtigtes Interesse zugestanden wurde. Dabei ist die Rechtsprechung des Schiedsgerichts sogar recht großzügig, da für einige Panels das Angebot von Waren und Dienstleistungen unter diesem Begriff oder eine nachweisliche Vorbereitung einer solchen Nutzung ausreichte, während im Falle von anderen beschreibenden Begriffen bereits der Hinweis auf die beschreibende Bedeutung des Domainnamens und die Absicht, diese zukünftig für entsprechende Waren und Dienstleistungen zu nutzen genügte.
Bösgläubigkeit
In der Rechtsprechung der Beschwerdepanels hat sich das Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit als das wichtigste und komplexeste Tatbestandsmerkmal heraus gestellt. Insbesondere dieses Kriterium zielt auf die Verhinderung von klaren und offensichtlichen Fällen spekulativer und rechtsmissbräuchlicher Domainregistrierungen (sog. Cybersquatting oder Domaingrabbing) ab. Auch hier enthält § 4 (b) UDRP eine beispielhafte Aufzählung von Bösgläubigkeitsfällen, die jedoch nicht abschließend ist. Die vier Beispiele formulieren die Fälle des Domaingrabbings, Cybersquattings, der vorsätzlichen Schädigung eines Mitbewerbers in seinen Geschäftstätigkeiten und der bewussten Schaffung einer Verwechslungsgefahr für Verwender, um diese auf die eigene Website zu locken.
Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit zählt aber nicht ein einziges Moment, sondern das Zusammenspiel aller Begleitumstände, die zur Domainregistrierung hinzutreten, vorausgehen oder auch nachfolgen. Der Wortlaut des § 4 (a) (iii) UDRP spricht von einem Domainnamen, der „bösgläubig registriert wurde und verwendet wird“, so dass zunächst ein kumulatives Vorliegen von Registrierung und Benutzung angenommen werden könnte, worüber sich die Beschwerde-Panels aber nicht einig sind. Einerseits erachten manche Panels die Voraussetzungen als alternativ, während andere strikt ein kumulatives Vorliegen von Registrierung und Benutzung erfordern. Große Gefolgschaft hat jedoch die vermittelnde Ansicht gefunden, die grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem Wortlaut ein kumulatives Vorliegen verlangt, jedoch das passive Registrierthalten eines Domainnamens der aktiven Benutzung bei Würdigung der Gesamtumstände der Registrierung gleichstellt. Ein solches Gleichsetzen kann jedoch nicht in jedem Fall erfolgen, sondern nur wenn der Markeninhaber sich
- auf eine Marke mit hohem Bekanntheitsgrad beruft,
- der Domaininhaber keinerlei Nachweis seiner Gutgläubigkeit erbringen konnte,
- seine wahre Identität durch Angabe falscher Kontaktdaten verberge und
- eine zulässige aktive Benutzung des Domainnamens durch den Beschwerdeführer aus markenrechtlichen Gründen oder sonstigen Rechtsgründen nicht vorstellbar sei.
Darüber hinaus haben sich in der Entscheidungspraxis unterschiedliche Indizien herausgebildet, die ( je nach Umständen des Einzelfalls) die Bösgläubigkeit des Domaininhabers vermuten lassen. Darunter fällt zum Beispiel die Beteiligung des Beschwerdegegners an früheren Beschwerdeverfahren, in denen die bösgläubige Registrierung eines Domainnamens festgestellt wurde, die Registrierung einer berühmten Marke, das unmittelbare Wettbewerbsverhältnis zwischen Beschwerdeführer und Beschwerdegegner oder die Angabe fehlerhafter Kontaktdaten in der Registrierungsvereinbarung.
Trademark Clearinghouse
Die Bösgläubigkeit eines Domaininhabers kann auch durch die Benachrichtigung des Trademark clearinghouses belegt werden. Die Einrichtung des Trademark clearinghouses ist eine Datenbank, in der Daten über hinterlegte Marken gesammelt werden, um diese den Registries der neuen Top-Level Domains zur Verfügung zu stellen und um Markeninhabern bessere Rechtsschutzmechanismen zur Verfügung zu stellen. Wer seine Marke nämlich beim trademark Clearinghouse hinterlegt, kann zwei unterschiedliche Service Angebote nutzen. Zum einen den „Sunrise“-Service, der es den Markeninhabern nach Hinterlegung der Marke ermöglicht, die bevorrechtigte Registrierung der Marke als Domainname unter einer neuen TLD zu erreichen, bevor deren allgemeine Registrierungsphase beginnt. Zum anderen wird der „Trademark Claims“ – Service angeboten. Dieser Service besteht darin, dass im Falle einer Anmeldung einer hinterlegten Marke als Domainname, der Anmelder über das Bestehen der Markenrechte informiert wird. Hält der Domainanmelder trotz entgegenstehender Rechte an der Registrierung fest, wird der Markeninhaber über diesen Prozess in Kenntnis gesetzt. Auswirkungen hat dieser Service auf das UDRP Verfahren insoweit, als dass eine solche Information des Domainanmelders über das Bestehen einer identischen Marke zur Bösgläubigkeit führt und dem Beschwerdeführer den Beweis darüber erheblich erleichtert. Bezüglich der gTLDs ist dies insbesondere von Vorteil, da die Registry-Betreiber der neuen Top-Level-Domains aufgrund des Registry Agreements mit der ICANN dazu verpflichtet sind, einen „Sunrise“- und „Trademark Claims“-Service anzubieten, um dem Schutz der Markeninhaber vor missbräuchlicher Domainregistrierung beizutragen.
Kosten
Nach den Supplement Rules der WIPO betragen die Kosten für ein Streitbeilegungsverfahren 1500 US-Dollar, wenn 1-5 Domainnamen involviert sind. Sind es 6-10 steigt die Gebühr auf 2000 US-Dollar und bei mehr als 10 entscheidet die WIPO nach eigenem Ermessen über die Höhe Gebühr. Diese Summen gelten jedoch nur für Entscheidungen durch nur einem Panelist. Setzen sich die Panels aus 3 Mitgliedern zusammen, ist eine Gebühr von 4000 US-Dollar bei 1-5 Domainnamen und eine Gebühr von 5000 US-Dollar bei 6-10 Domainnamen fällig. Auch hier kann bei mehr als 10 Domainnamen im Austausch mit der WIPO verhandelt werden. Die Kosten für die anderen Beschwerdestellen sind etwas geringer. Insgesamt sind die Kosten dieses Streitbelegungsverfahrens aber im Vergleich zu anderen internationalen kennzeichenrechtlichen Streitigkeiten recht gering.