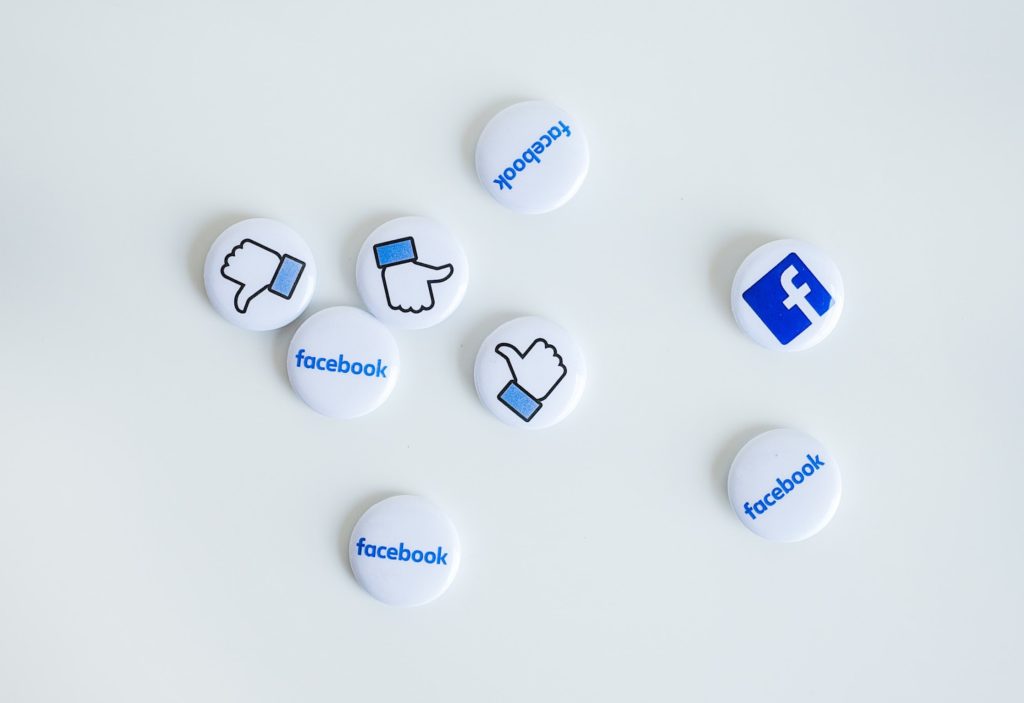Wir beleuchten die Änderungen des neuen Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetzes.

Überblick zum zweiten Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz (2019)
Einleitung
Schon 2017 hat der Bundestag ein Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz erlassen. Dieses umfasste allerdings nur die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), um dieses an die DS-GVO (Verordnung (EU) 2016/679) anzupassen. Mit dem zweiten Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz (2. DSAnpUG) hat der Bundestag nun auch das bereichsspezifische Datenschutzrecht des Bundes an die seit Mai 2018 geltende Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) angepasst.
Zusätzlich soll mit dem zweiten Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz die Richtlinie (EU) 2016/680 (JI-Richtlinie) zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des Rates umgesetzt werden. Mit dieser soll ein einheitlicher Rahmen in der EU für den Bereich der Polizei und Justiz geschaffen und ein höheres Datenschutzniveau in der Union erreicht werden.
Um den Vorgaben aus dieser Richtlinie nachzukommen, hat der Gesetzgeber im 2. DSAnpUG zahlreiche Änderungen bestehender Gesetze vorgenommen. Der Bundesrat hat dem Gesetz am 20. September 2019 zugestimmt. Es soll am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft treten.
Änderungen
Im Folgenden werden auszugsweise einige Änderungen aufgelistet.
BDSG: Benennung des Datenschutzbeauftragten
Die am meisten spürbare Änderung wird sicherlich die Erhöhung von zehn auf 20 Mitarbeiter als Voraussetzung für die Benennung eines Datenschutzbeauftragten gem. § 38 Abs. 1 S.1 BDSG im Unternehmen sein. Dabei ist zu bedenken, dass die Pflicht zur Einhaltung der Datenschutzauflagen natürlich weiter besteht und es nun vor allem an den Mitarbeitern und dem Vorgesetzten liegt, diese einzuhalten. Dies ist einerseits ein Vorteil für kleine Unternehmen, wie zum Beispiel Start-Ups, andererseits verringert es die Verbreitung eines Bewusstseins für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.
Ob durch den Wegfall eines Datenschutzbeauftragten nicht nur Bürokratie, sondern auch Kompetenz und Sachverstand abgebaut wird und zu einem laxeren Umgang mit dem Datenschutzrecht führt, wird sich in der Praxis zeigen.
BDSG: Elektronische Einwilligung zur Datenverarbeitung
Als weitere Änderung ist § 26 Abs. 2 S. 3 BDSG zu nennen. Momentan ist bezüglich der Einwilligung für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Mitarbeitern im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen nur die Schriftform vorgeschrieben. Dieses Schriftformerfordernis fällt weg. Stattdessen soll mit dem 2. DSAnpUG künftig auch eine elektronische Einwilligung des Betroffenen zugelassen werden.
BDSG: Verarbeitung bei erheblichem öffentlichem Interesse
In § 22 Abs. 1 Nr. 1 BDSG wird mit lit. d) ein neuer Erlaubnistatbestand für öffentliche und nichtöffentliche Stellen eingefügt. Demnach soll die Verarbeitung von besonderen Datenarten zulässig sein, wenn diese „bei einem erheblichen öffentlichen Interesse zwingend erforderlich ist“.
Damit wird der Erlaubnistatbestand bei Vorliegen von öffentlichem Interesse aus § 22 Abs. 1 Nr. 2 lit. a) BDSG, der bislang nur für öffentliche Stellen galt, auch auf nichtöffentliche Stellen ausgeweitet.
BDSG: Verarbeitung bei Auszeichnungen und Ehrungen
Mit § 86 BDSG wird ein komplett neuer Paragraph hinzugefügt. Damit sollen im Rahmen der „Vorbereitung und Durchführung staatlicher Verfahren bei Auszeichnungen und Ehrungen sowohl die zuständigen als auch andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen die dazu erforderlichen personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 (DS-GVO), auch ohne Kenntnis der betroffenen Person verarbeiten“ dürfen.
Zivilprozessordnung und Grundbuchordnung
Die Zivilprozessordnung und die Grundbuchordnung werden im Rahmen der Auskunftsrechte an die Bestimmungen des Art. 15 DS-GVO angepasst.
Der Zivilprozessordnung wird § 882i hinzugefügt. Danach kann die betroffene Person Einsicht in das Schuldnerverzeichnis über die zentrale und länderübergreifende Abfrage im Internet nach § 882h Abs. 1 Satz 2 ZPO nehmen. Eine Information der betroffenen Person über konkrete Empfänger, gegenüber denen die personenbezogenen Daten, die im Schuldnerverzeichnis und in den an das zentrale Vollstreckungsgericht übermittelten Anordnungen der Eintragung in das Schuldnerverzeichnis enthalten sind, offengelegt werden, erfolgt nur insoweit, als Daten zu diesen Empfängern nach den Vorschriften für Zwecke der Datenschutzkontrolle zu speichern sind
Die Grundbuchordnung wird um § 12d ergänzt. Dieser ermöglicht der betroffenen Person, die als Eigentümer oder Inhaber grundstücksgleicher Rechte von Grundstücken eingetragen ist, ein Auskunftsrecht nach Art. 15 DS-GVO. Konkret sind das: das Grundbuch, die Urkunden, auf die im Grundbuch zur Ergänzung einer Eintragung Bezug genommen ist und die noch nicht erledigten Eintragungsanträge.
Wenn Sie weitere Fragen zur neuen Rechtslage haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!