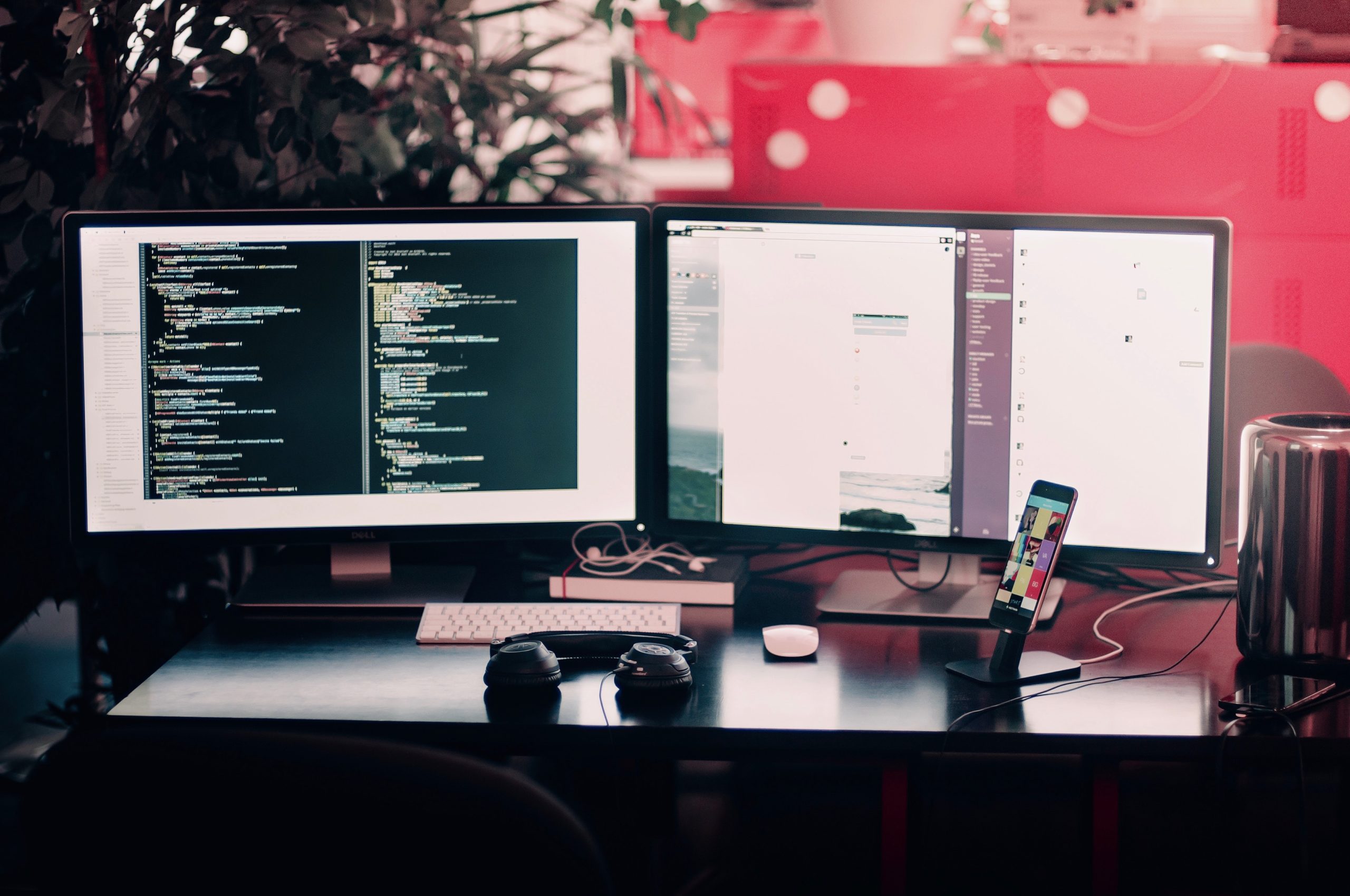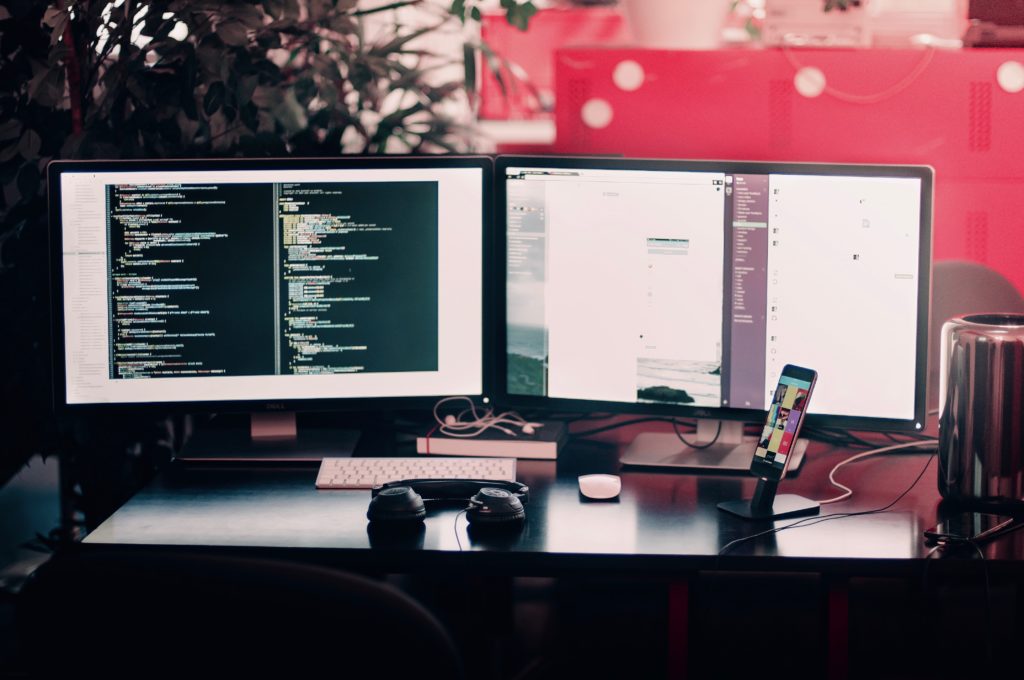Wir erklären die arbeitsrechtlichen Maßnahmen bei unterlassener Meldepflicht hinsichtlich Datenschutzvorfällen.

Fehlerkultur im Zusammenhang mit Datenpannen
Spannungsfeld zwischen Meldepflicht und arbeitsrechtlichen Sanktionen
Die Zahl bei den Landesaufsichtsbehörden für den Datenschutz gemeldeten Datenvorfällen ist seit Einführung der DS-GVO gestiegen. Allein in NRW wurden im Jahr 2019 12.500 Fälle gemeldet. Davon waren 2.235 Meldungen sog. Datenpannen gem. Art. 33 DS-GVO. Die Datenpannen werden häufig durch die eigenen Mitarbeiter verursacht. Dies geschieht unter anderem durch das Öffnen von Phishing-Emails, Datenweitergabe an Unbefugte, etwa in Form von fehladressierten E-Mails, oder das Unterlassen von Updates. Die Folgen für das Unternehmen können verheerend sein. Neben den datenschutzrechtlichen Sanktionen, insbesondere hoher Geldbußen, erwartet das Unternehmen auch einen Imageschaden. Die Meldung eines solchen Vorfalls dient daher als zentrale organisatorische Maßnahme im Unternehmen und sorgt für den Schutz der IT-Infrastruktur und somit auch des Datenschutzes. Dennoch kommen viele Arbeitnehmer ihrer Meldepflicht aus Furcht vor den arbeitsrechtlichen Konsequenzen nicht nach.
Was sind die Voraussetzungen für die Meldepflicht?
Die Meldepflicht des Arbeitgebers an die entsprechenden Aufsichtsbehörden bei Datenpannen ergibt sich aus Art. 33 DS-GVO. Die DS-GVO sieht jedoch kein standardisiertes Vorgehen für die Meldung durch den Arbeitnehmer vor. Die Meldepflicht von Arbeitnehmern für IT-Sicherheits- und Datenschutzvorfälle ergibt sich zum einen aus dem Arbeitsverhältnis und zum anderen aus den vom Arbeitgeber eingeführten Security Policies ergibt.
Voraussetzung für die Meldepflicht ist das Wissen des Mitarbeiters über IT- oder Datenschutzvorfälle. Zudem dient die Meldepflicht dazu, dass der Mitarbeiter seiner Schadensminderungspflicht gegenüber seinem Arbeitgeber nachkommt.
Bei Verletzung der Meldepflicht sind die arbeitsrechtlichen Konsequenzen meist abhängig vom Schweregrad des Sicherheitsfehlers. Bei schweren Pflichtverletzungen ist eine ordentliche oder fristlose Kündigung möglich, wie es beim aktuellen Datenschutzvorfall des VfB Stuttgarts zu sehen ist Bei weniger schweren Pflichtverletzungen kommt vielleicht nur eine Abmahnung in Betracht. Letztlich entscheidet der Einzelfall. Da man aber nicht direkt die Schwere des Schadens abschätzen kann, könnte sich aus einem Bagatellschaden noch ein größerer Sicherheitsschaden entstehen und schließlich doch zu härteren arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. Die Beweislast trifft in der Regel den Arbeitgeber.
Die angedrohten Sanktionen und die darin enthaltene Selbstbelastung können dazu führen, dass die Mitarbeiter die Sicherheitsvorfälle nicht anzeigen und es kommt zu einem Unterlassen der Meldepflicht.
Verzicht auf arbeitsrechtliche Sanktionen?
Die arbeitsrechtlichen Grundsätze zum innerbetrieblichen Schadenausgleich besagen, dass der Arbeitnehmer nur haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, sowie bei mittlerer Fahrlässigkeit nur anteilig haftet. Bei Vorfällen, die auf fahrlässiges oder leicht fahrlässiges Verhalten des Arbeitnehmers basieren, könnte demnach auf eine arbeitsrechtliche Sanktion verzichtet werden.
Auf diese Weise können die Mitarbeiter motiviert werden ihre Meldepflicht einzuhalten, selbst wenn ein Fehlverhalten ihrerseits vorliegt. Dem Arbeitgeber ist diese Überlegung zu empfehlen, da er auf die zeitnahe Meldung des Arbeitsnehmers angewiesen ist, um größere Schäden am Unternehmen zu vermeiden. Ein gänzlicher Verzicht ist in der Praxis nicht möglich, da sich die Arbeitnehmer sonst nicht mehr verpflichtet fühlen würden die arbeitsrechtlichen Regelungen einzuhalten. Ferner muss der Arbeitgeber in der Lage sein der eigenen gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen, die im Fall von Art. 33 DS-GVO innerhalb von 72 Stunden nach Kenntniserlangung erfolgen muss. Die Frist wird auch dann ausgelöst, wenn ein Wissensvertreter Kenntnis über die Datenpanne erlangt hat.
Zusätzliche Maßnahmen zur Einhaltung der Meldepflicht?
Der Arbeitgeber sollte interne Prozesse festlegen, um Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten aufdecken und abstellen zu können. Dazu kann ein “incident response plan” eingeführt werden, der eine umgehende Weiterleitung an die Führungsebene ermöglicht. Diesbezüglich helfen interne Richtlinien weiter, welche u.a die Definition von Datenpannen umfasst und die Verantwortlichen sowie weitere Ansprechpartner nennt.
Im Allgemeinen empfiehlt es sich, die Mitarbeiter für das Thema Meldepflicht und die damit einhergehenden Schäden besser zu sensibilisieren. Denn um den Mitarbeiter überhaupt in die Haftung miteinzubeziehen, muss dieser auch fähig sein IT-Sicherheits- und Datenschutzvorfälle zu erkennen. Sensibilisierungsmaßnahmen können in Form von IT-Security-Schulungen oder Awareness Trainings erfolgen.
In Anlehnung an die Whistle-Blower-Fälle könnte man ein anonymisiertes und/oder pseudonymisiertes Meldesystem einrichten, welches eine „sichere“ Meldung von Vorfällen ermöglicht. Der Nachteil an einem Meldesystem ist jedoch meist die gänzliche Pflichtentbindung des Arbeitnehmers bei Verursachung eines Sicherheitsfehlers.
LAG Kiel nimmt eine andere Betrachtung vor
Das LAG Kiel hat in einem Urteil vom 06.08.2019 entschieden, dass die Meldung einer Datenpanne keine arbeitsvertragliche Pflicht des Arbeitnehmers darstellt. Im betreffenden Fall hat der Arbeitgeber ein standardisiertes Meldeverfahren in Form einer Arbeitsanweisung festgelegt. Die inhaltlichen Vorgaben der Arbeitsanweisung stellten laut LAG Kiel ein Ordnungsverhalten dar, welches der zwingenden Mitbestimmung des Betriebsrates gem. § 87 Abs.1 Nr.1 BetrVG unterliegt.
Dabei verkennt das Gericht allerdings die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, wonach positiv festgestellt werden muss, ob eine Maßnahme die betriebliche Ordnung betrifft. Eine derartige Feststellung ist der Entscheidung des LAG Kiel nicht zu entnehmen.
Diese Entscheidung des LAG Kiel ist insbesondere auch in eiligen Datenschutzfällen fragwürdig. Denn liegt eine mitbestimmungswidrige Anweisung des Arbeitgebers vor, ist diese nicht verbindlich für den Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ist somit nicht verpflichtet eine Datenpanne zu melden. Gerade im Hinblick auf die Meldefrist für den Arbeitgeber durch die DS-GVO erscheint diese Vorgehensweise nicht praktikabel.
Abzuwarten bleibt, ob und wie das BAG sich zu dieser Betrachtung äußert.
Fazit
Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse lohnt es sich also für den Arbeitgeber auf Sanktionen wie Abmahnung oder Kündigung in gewissen Fällen zu verzichten. Statt übermäßiger Sanktionierung sollte im Unternehmen eine umfassende Aufklärung über die Meldepflicht und die Konsequenzen bei Unterlassung erfolgen, damit die Arbeitnehmer bei Erkennen eines Datenschutzvorfalls schneller agieren. Ferner sollte eine Abstimmung mit den Sozialpartnern erfolgen, damit keine Komplikationen bei Einführung von Meldesystemen entstehen.