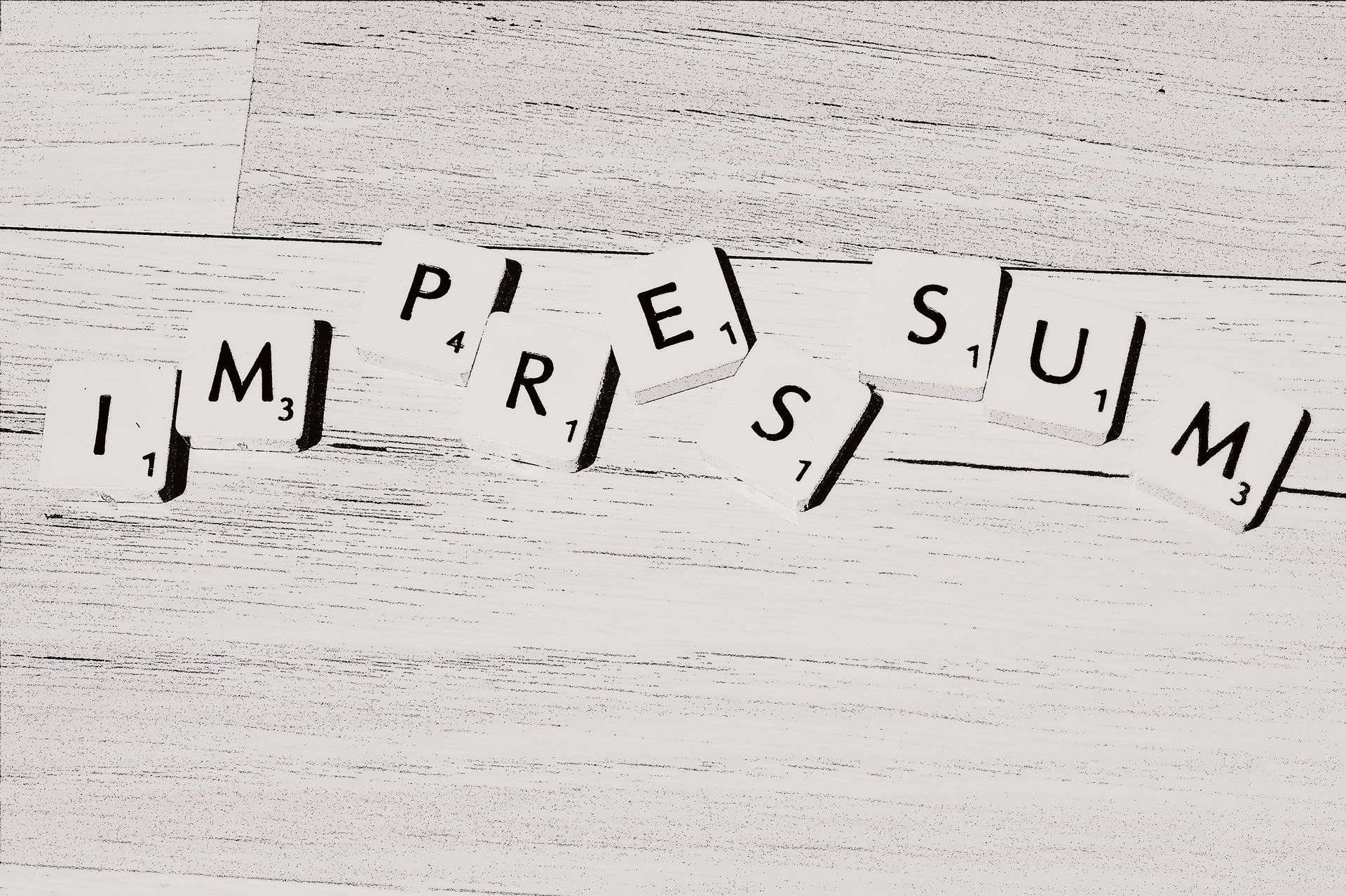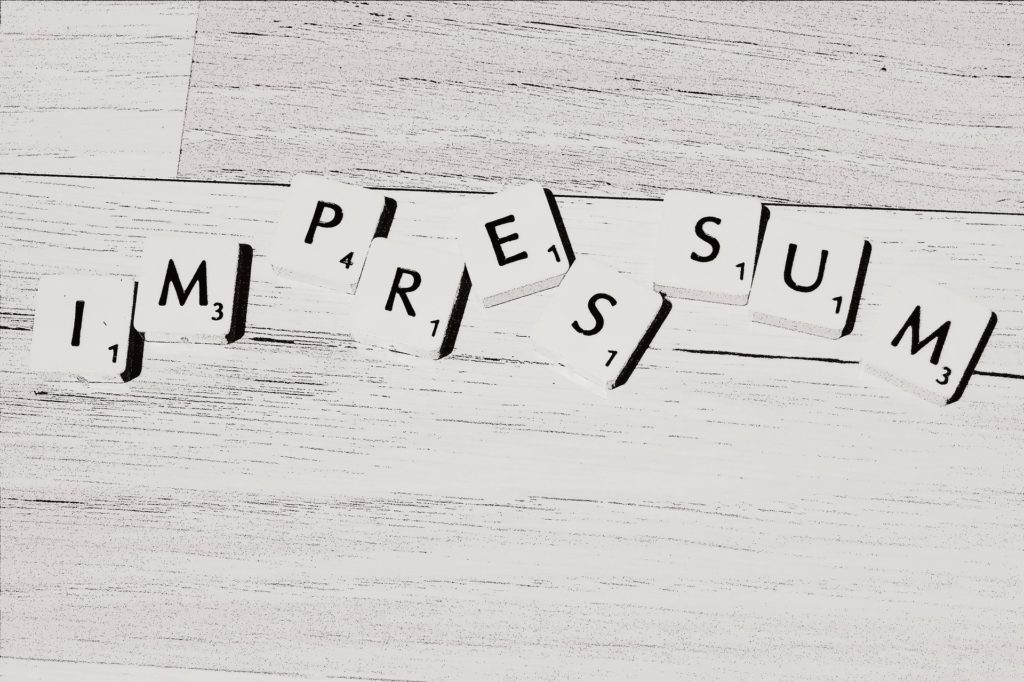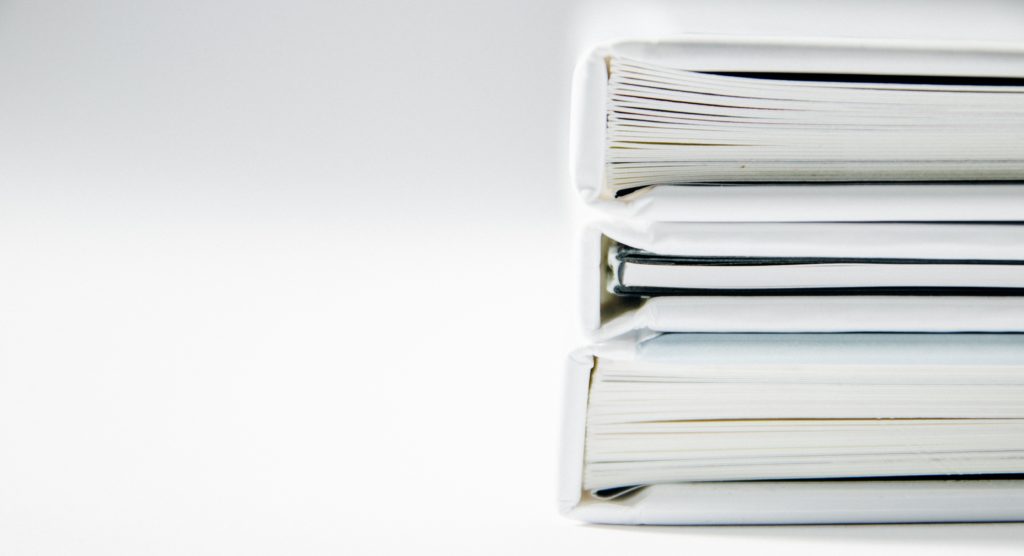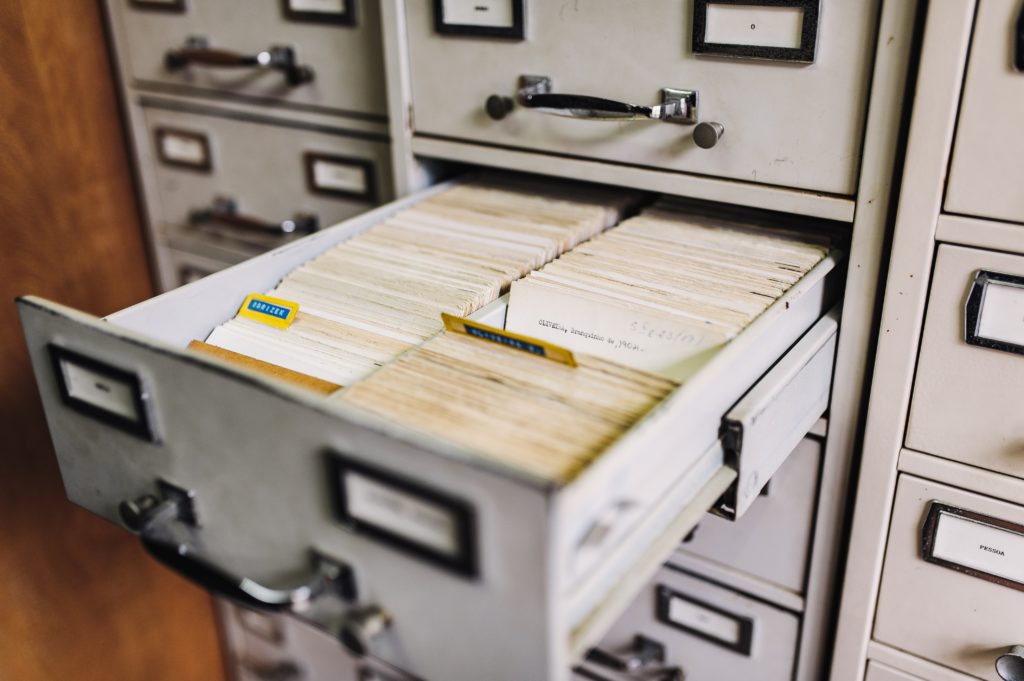Von der Kita bis zur Schule: Wir gehen auf den Datenschutz in Bildungseinrichtungen ein.

Einführung
Im Datenschutz gilt: es dürfen keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden, soweit kein Gesetz dies erlaubt. Das regelt Art. 6 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Dieser Grundsatz des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt kann darauf zurückgeführt werden, dass jeder Mensch das Recht über seine Daten hat. Aus dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung kann abgeleitet werden, dass jedem Menschen die Freiheit zusteht, selber entscheiden zu können, welche Daten wem, wann und zu welchem Zweck zugänglich sind. Dieses Recht steht jedem Menschen zu. Problematisch ist dies allerdings dann, wenn es um Minderjährige geht, die in der Regel nicht die nötige Entscheidungsreife besitzen und abwägen können, inwiefern sie selbst über ihre Daten verfügen sollten. Daher sind in der Regel die Eltern des Kindes nach § 1626 Abs. 1 BGB zur elterlichen Sorge verpflichtet, was auch die Sorge für die Person des Kindes umfasst. Sie entscheiden für das Kind in Sachen Datenschutz und vertreten es auch nach außen gemäß § 1629 Abs. 1 BGB.
Als Ausnahme des Grundsatzes des Verbotes mit Erlaubnisvorbehalt können Kitas bestimmte Datennutzungen auch ohne Einwilligungen durchführen. Hierzu zählt die Nutzung von personenbezogenen Daten, die zur Gewährleistung der Betreuung notwendig ist. Erlaubt ist demnach die Erhebung folgender Daten:
- Name, Adresse, Geburtstag des Kindes
- Name, Adresse und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter (idR. Eltern)
- Krankheiten, Allergien und Impfungen des Kindes
- Kontaktdaten des Kinderarztes/ Hausarztes
Über die notwendigen Daten hinaus dürfen nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, deren Verarbeitung durch einen gesetzlichen Erlaubnistatbestand oder eine DS-GVO-konforme Einwilligung nach Art. 7 DS-GVO gerechtfertigt wird.
Foto- und Videoaufnahmen
Ein wesentliches datenschutzrelevantes Thema rund um Schule und Kita ist der Bereich der Foto- und Videoaufnahmen. Fotos und Videos fallen unter die personenbezogenen Daten. In der Regel sind die Aufnahmen nicht für die Aufgabe der Schule, nämlich den Bildungsauftrag, erforderlich, sodass sie nicht „per se“ verarbeitet werden dürfen. Die Fotografie eines Kindergartenkindes oder Schülers bedarf also mangels gesetzlicher Ermächtigung einer Einwilligung.
Unter „diese Einwilligung“ fällt nicht automatisch auch die Veröffentlichung der Aufnahmen auf Homepages o.ä., weshalb es einer weiteren Einwilligung der Eltern dafür bedarf. Wichtig ist hier, dass sich die Einwilligung konkret auf den Zweck der Veröffentlichung auf der Homepage oder auch nur auf den Gemeinschaftsraum der Schule/Kita bezieht.
Während sich die Fotografie als solche nach den Vorschriften der DS-GVO richtet, findet im Bereich der Veröffentlichung von Fotos und Videos das Kunsturhebergesetz (§ 22 KUG) Anwendung. Inwiefern das KUG jedoch neben der DS-GVO anwendbar ist, ist umstritten. Hinsichtlich dieser Problematik gibt es bislang noch keine absolute Rechtssicherheit. Einer Stellungnahme des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat nach zu urteilen gilt das KUG in Bezug auf die Verbreitung von Foto- und Videoaufnahmen neben der DS-GVO. Danach bedarf es einer Einwilligung nach § 22 KUG, die im Vergleich aber geringere Anforderungen als die Einwilligung nach Art. 7 DS-GVO hat.
Aktuelles Ereignis: Kita schwärzt Kinderfotos aus DS-GVO Panik
Kürzlich sorgte eine katholische Kindertagesstätte für mediales Aufsehen, als sie Erinnerungsfotoalben an den ältesten Jahrgang verteilte, die Fotos allerdings zuvor durch Edding geschwärzt hatte, sodass jeweils nur das Kind zu sehen war, dem das Erinnerungsfotoalbum geschenkt wurde. Die Kita begründete ihr Handeln mit einer Vorbeugung von Klagen aufgrund der DS-GVO. Dieses profane Mittel, stellte jedoch gleichzeitig eine sehr radikale Vorgehensweise dar und ist wohl als Widerspruch zu der tatsächlichen Absicht eines Erinnerungsfotoalbums anzusehen. Als ein „milderes Mittel“ hätte es hier bereits ausgereicht die Einwilligung der Eltern für den Abdruck und die Verteilung einzuholen. Da es sich in dem Spezialfall um eine katholische Kindertagesstätte handelte, ist das speziellere Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG) vor der DS-GVO anzuwenden. Aber auch nach dem KDG ist eine Einwilligung einzuholen, welche sich bis auf eine Formvorschrift bei §§ 6, 8 KDG nicht von der DS-GVO Vorschrift unterscheidet.
Alte Einwilligungen
Wurden bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO am 25. Mai 2018 Einwilligungen der Eltern von Kindern eingeholt, sind diese nicht automatisch anwendbar, sondern müssen auf ihre Konformität mit der DS-GVO geprüft werden. Nur wenn die „alte“ Einwilligung auch die Voraussetzungen des Art. 7 DS-GVO erfüllt, kann sie auch weiterhin als Rechtsgrundlage für Datenverarbeitungen genutzt werden.
Digitalisierung in der Schule
Häufig nutzen Lehrer im Zeitalter der Digitalisierung bei der Unterrichtsgestaltung digitale Medien. Einige Beispiele dafür sind Clouds und digitale Klassenbücher. Auch hier gilt: ohne eine gesetzliche Ermächtigung oder Einwilligung dürfen nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die erforderlich sind. Darüber hinaus dürfen weitere Daten von Schülern nur genutzt werden, wenn das Gesetz das vorschreibt oder die Eltern für ihre Kinder darin eingewilligt haben.
Schülerfotos zur Namenseinprägung
So manch ein Lehrer ist zu Beginn eines Schuljahres mit der Fülle an neuen Schülern überfordert und macht es sich schwer, die Namen der Schüler zu lernen. Kommt ein Lehrer auf die Idee, Schülerfotos mit Sitzplänen zu erstellen, ist das aus datenschutzrechtlicher Sicht insofern problematisch, als dass die Lehrer dafür wohl im seltensten Fall eine Einwilligung der Eltern eingeholt haben dürften. Die klassische Form von Namensschildern, die aufgestellt werden, erscheint insofern nach wie vor als bewährtes Mittel.
Schulfotos
Jedes Jahr ist es zu Beginn eines neuen Schuljahres soweit: der Fotograf kommt. Indem der Schulfotograf (nach erteilter Einwilligung der Eltern) Bilder von den Schülern anfertigt, handelt er immer noch im Weisungsbereich der Schule. Die Schule hat dafür einzustehen, dass die durch die Fotografie erhobenen personenbezogenen Daten der Schüler weiterhin umfassend geschützt werden. Dafür hat die Schule mit dem engagierten Fotograf einen Auftragsverarbeitungsvertrag anzufertigen, indem der Fotograf sich verpflichtet, die Anforderungen der DS-GVO einzuhalten.
Fazit
Es kann unstreitig festgestellt werden, dass sich in Bezug auf die Themen Kita und Schule viele datenschutzrechtliche Hürden ergeben. Die Besonderheit ergibt sich daraus, dass zwar jede Kita und jede Schule anders ausgerichtet sein mag, allerdings das Thema Datenschutz überall zur Anwendung kommt. Nichtsdestotrotz bleibt es eine Frage des Einzelfalles. Haben Sie daher Fragen rund um dieses Thema, dann helfen wir Ihnen sehr gerne.